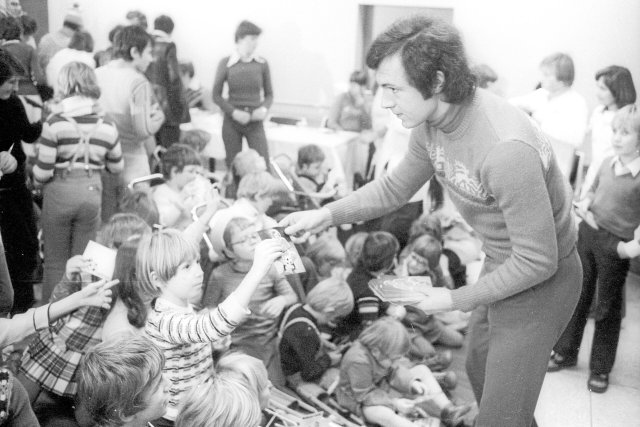Kleiner Kudamm Die Bölsche - ein Straßenzustandsbericht aus Berlin-Köpenick
Für viele ist die Bölsche mit ihren Häusern unter Denkmalschutz eine Einladung. Mancher wird vorm Umzug aus Marzahn, Lankwitz oder Lichtenberg diesen ländlichen Boulevard kennen gelernt haben, ehe er ganz in die Kleinstadt am Südostrand zog, wo mit dem Müggelsee Berlins größtes Gewässer und ausgedehnte Wälder noch innerhalb der Stadtgrenze liegen.
Unter allen Hauptstadtbezirken ist Treptow-Köpenick der größte, grünste und wasserreichste. Das erhöht die Beliebtheit der Bölsche und trägt dazu bei, dass Köpenick zu den Ecken Berlins gehört, wo mehr Menschen zu- als wegziehen. Die Tatsache, dass die Bölsche im Winter nach 18 Uhr tot ist, beißt sich damit nicht. Die Bewohner scheinen das zu suchen: Überschaubare Geschäftigkeit, wenn der Tag kommt, verlässliche Ruhe, wenn er geht. Polizeioberrat Gösta Köhler spricht von »einem guten Wohnbereich« und davon, dass »Menschen sich hier sicher fühlen können«. Der Mann aus dem Raum Stuttgart leitet den Polizeiabschnitt 67 vom früheren Friedrichshagener Rathaus aus und ist mit einem Vorzimmer geadelt, in dem sich einst das Standesamt befand.
1920 wurde Friedrichshagen Berlin eingegliedert, und im Mai begeht der Ortsteil - mit der Bölsche im Mittelpunkt - sein 250. Jubiläum. Anhaltspunkt ist der 29. Mai 1753, als Friedrich II. die Gründung Friedrichshagens bestätigte, die der Domänenrat Johann Friedrich Pfeiffer in seinem Auftrag vorgenommen hatte. 50 Doppelhäuser, Kuhweiden und anfängliche Steuerfreiheit wurden Feinwollspinnern und Webern als Anreiz geboten. So kamen Kolonisten ins dünn bewohnte Brandenburg.
Vor zwei, drei Jahrzehnten hatte im Londoner West End eine kleine Revolution des Wohnens begonnen: Auf der Rückseite von Straßenhäusern gelegene einstige Stallungen wurden zu teuren so genannten Mews umgebaut. Ähnliches geschieht heute auf den tiefen Grundstücken hinter den Front-Häusern der Bölsche. Remisen aus Friedrichshagens Frühepoche sind Renner bei Anwälten, Architekten und anderen, die den Euro höchstens einmal umdrehen müssen und sich in den Gärten hinter der Bölsche ins noch grünere Grün zurückziehen - ohne den Reiz der Straße zu verlieren.
Viele Geschäftsnamen »von der Stange« säumen die Bölsche, aber auch viele Läden, wo die Kunden-Hoffnung auf Einzelfallbetreuung nicht als Zumutung gilt. Ein Lichthaus und ein Fliesenstudio, Kosmetikpraxen und Parfümerien, Reisebüros, Weinhaus, Teestübchen und - absehbar - zwei Cafés, eine Fleischerei, die verdient die Konkurrenz gegen Kaiser's besteht, eine der 18 Berliner Stadtmissionen der evangelischen Kirche, Platten- und Buchläden, kleine Galerien, Antiquariat und ein reizendes Interieur-Geschäft, Glasereien und Bilderladen, 25 Arzt- und Zahnarztpraxen, drei Optiker, sieben Friseure und fünf Schuhläden, vier »Italiener« - ein fünfter, das »Bella Napoli«, und nicht der schlechteste, nebenan.
16 Restaurants und Imbisse zählt die Straße. Alte wie »Die Spindel« mit solider deutscher Küche oder »Das Bräustübl«, das am Müggelseedamm die Bölsche beschließt und zu Berlins grünster Brauerei Bürgerbräu gehört. Auch neuere Adressen wie »Café le métier« oder »Kiboko«, die es schon in Berlin-Reiseführer geschafft haben, zwei »Chinesen«, ein »Japaner«, das leicht szenige »Josef Heinrich« oder eben die »Italiener«. Die Gastronomie ist stark gewachsen. Ebenso die Mode: 18 Boutiquen, Ateliers und andere Textilgeschäfte bestehen. In einigen gibt es ebenso elegante wie trag- und finanzierbare Stücke. Die Optikerin Rosel Kaminski (52) wohnt mehr als 30 Jahre in Friedrichshagen und fährt wegen des Modeangebots »seit längerem nicht mehr in die Stadt. Die Bölsche-Straße ist die Lebensader. Andererseits: Wenn ich will, setze ich mich in Auto oder S-Bahn und bin in einer halben Stunde im Weltgeschehen.«
In Frau Kaminskis Worten klingt die Zufriedenheit einer sich selbst genügenden geschlossenen Gesellschaft. Die Menschen hier wohnen nicht »in Berlin«, nicht mal in Treptow-Köpenick (233 000 Einwohner), zu dem Friedrichshagen mit seinen 16744 »melderechtlich registrierten« Einwohnern gehört. Sie leben »in Friedrichshagen«. Mancher betont das mit feinem Dünkel. Giletta Katesscenka in der Touristen-Info auf dem Marktplatz wohnt in Köpenick und beobachtet zum Beispiel, »dass von Literatur und Karten in Friedrichshagen nichts so gut geht wie Material aus Friedrichshagen über Friedrichshagen.«
Viele Bürgerhäuser säumen die schnurgerade Straße. Fast alle sind nach der Wende denkmalsgerecht restauriert worden. Einige, darunter die »Süße Ecke«, gleich neben dem brach liegenden und leider wohl nicht wieder zu belebenden Kino Union, liefern einen erbarmenswürdigen Kontrast. Sie gehören zum Erbe des unfreiwillig erfolgreichen DDR-Programms »Ruinen schaffen ohne Waffen«. Trotz manch alter und neuer Verwahrlosung sind die Laden- und Gewerbevielfalt Trümpfe der Straße. Bäckermeister Rainer Schwadtke in der »Dresdner Feinbäckerei« wünscht sich noch ein paar andere Läden. Ihm ist die Zahl der Mode-Geschäfte schon zu groß, so wie der Chef des gegenüber liegenden Fahrradhauses hofft, »dass der Branchen-Mix sich verbessert«. Schwadtke behauptet sich gegen die Geschäfte großer Ketten. Er bäckt »ohne die heutigen Aufblasstoffe«. Drei Mal hat das ZDF die restaurierte alte Einrichtung des Ladens und die Backstube zu Dreharbeiten für eine Kinder-Serie genutzt, und regelmäßig öffnet er seine Backstube Kindergartengruppen und Erstklässlern zum Anschauungsunterricht.
Wie er spüren viele Händler und Gewerbetreibende wirtschaftliche Probleme. »Die beiden ersten Jahre nach der Wende lief hier nichts. Totentanz. Alles guckte nach dem Westen. Dann ging es bergauf. Doch seit Herbst 1997 kämpft die Straße mit einem Umsatzeinbruch, von dem wir uns wahrscheinlich nie wieder ganz erholen.« Gewerbemieten von 30 Euro und mehr pro Quadratmeter tun ihr Übriges. Sie sorgen mit für Schließungen und Geschäftswechsel.
Auch Birgit Barnewski, einen der jüngsten Neuzugänge im Geschäftsleben der Straße, drücken die Mieten empfindlich. Aber die 59-jährige Kauffrau hat sich mit Eröffnung einer Mode-Boutique vergangenen Sommer einen alten Wunsch erfüllt. »Ich wollte schon lange etwas eröffnen, fand aber nie ein Geschäft, das zu haben war.« Nun ist sie in der ruhigeren, Müggelsee-nahen Hälfte gelandet, dennoch zuversichtlich, dass sie mit ihrer »Damenmode für Frauen ohne Alter« Fuß fassen kann. Das »Flair zwischen Dorf und Stadt, Segeln, Rudern und Radeln ist zum Wohlfühlen«.
Der Inhaber des Fahrradhauses, Jürgen Spieß (59), hat noch zehn Jahre DDR in seinem Geschäft erlebt (»oft musste ich einen Kollegen an der Tür postieren, der die Kunden schubweise einließ«) und fast 13 Jahre Westen. Spieß ist eines der aktivsten Mitglieder der »Werbegemeinschaft Friedrichshagen«, einem Zusammenschluss von Gewerbetreibenden mit dem Anliegen, »die Bölsche über die Grenzen Köpenicks hinaus bekannt zu machen. Hier gibt's Großstadt- und Urlaubsflair nebeneinander - welche andere Straße in Berlin hat das zu bieten!«. Die Mitgliedszahl von rund 50 im Werbeverband befriedigt ihn nicht. 70 bis 80 könnten es sein, darunter mehr Gaststätten und einige Ärzte, sagt er. Die Vereinsmitglieder zahlen monatlich 25 Euro. Davon finanzieren sie kleine Aktionen: Spots im Radio, Zeitungsanzeigen, den Weihnachtsbaum, Stelzenläufer oder Osterhasen, die auf dem Bürgersteig Süßigkeiten verteilen.
Dennoch: Die Kaufkraft ist bei vielen dahin. Antiquar Olaf Drescher (38) kam vor sechs Jahren aus dem Westberliner Zehlendorf auf die Bölsche. Nach anfangs guten Umsätzen erlebt er seit längerem eine Flaute. Sein zweites Antiquariat in Zehlendorf hält den Laden am Müggelsee mit über Wasser. Drescher gefällt die Atmosphäre in der Bölsche, obwohl die Zeiten vorbei seien, »da Kunden mit drei Plastetüten Bücher den Laden verließen, um sich günstig Titel zu besorgen, die sie in der DDR nicht immer bekamen: Strittmatter und Fühmann, Bulgakow und Frisch«.
Fielmann ist an Markt und Kirche bestens platziert. Unter den heute 19 Konzernfilialen in Berlin war sie im Dezember 1993 die erste in der Hauptstadt überhaupt. Geschäftsführerin Claudia Grobbel lebt im Westberliner Lankwitz und stammt aus dem Sauerland. Seit vier Jahren ist sie in Friedrichshagen Chefin. Sie freut sich, dass noch nicht so viele große Handelshäuser die Straße uniformiert haben und genießt »den Charakter der Gemeinde, die für mich gar nicht wie Berlin wirkt«. Sie stört sich daran, dass »man morgens bisher nirgends nett im Sitzen Kaffee trinken kann« bzw. schon jetzt »zu viele Handy-Läden und Apotheken da sind«. Sie bedauert, dass die Mehrzahl der anderen Geschäfte nicht mitgezogen hat, unter der Woche bis 20 Uhr zu öffnen. »Außer der Rathaus-Apotheke standen wir allein.«
Die Chefin der Rathaus-Apotheke, Ingeborg Zeige (62), leitet die älteste Apotheke Friedrichshagens (1875) seit April 1991. Sie ist im Kiez geboren, für ihren Ratgeber-Beruf ein zusätzlicher Vorteil. Für Frau Zeige ist die Bölsche »eine der wenigen echten Gewerbestraßen Berlins, dazu in herrlicher Ausflugsgegend. Fast jedes Haus besitzt Gewerberäume. Das ist ein großer Vorzug und macht die Straße zur natürlichen Laufgegend für Einheimische und Ausflügler.«
Die heutige Geschäftvielfalt genügt ihr jedoch nicht. Das bezieht sie auf die Apotheken (»die Straße ernährt auf Dauer keine vier«) wie auf andere Branchen. Sie begrüßt, dass inzwischen viele Geschäftsleute im Frühling die Ringe um die Straßenbäume vor ihren Läden mit Blumen bepflanzen. Sie freut sich »an den Häusern, die nach dem traurigen Verfall vor der Wende heute das Schönste in der Straße sind«, und fürchtet die neuen Einkaufszentren auf der grünen Wiese. »Die machen den lebendigen Charakter einer Straße in der Stadt kaputt.« Insofern ist für sie die Zukunft der Bölsche noch nicht gesichert.
Marion Schulz hat's da leichter: Sie ist Friedrichshagenerin und Kundin. »In der Bölsche ist man nicht ganz draußen und nicht ganz drinnen - wie der Kudamm, nur gemütlicher.«
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.