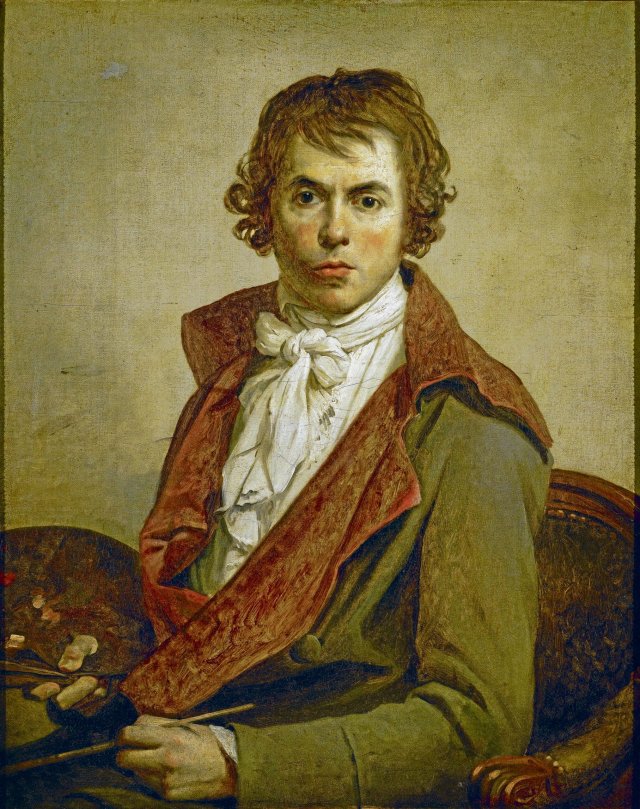»Stabhochsprung« von Etienne-Jules Marey (1830-1904) - die Aufnahme von 1890 ist eines von 50 Meisterwerken, die in dem Band »Fotografie! - Das 19. Jahrhundert« abgebildet und beschrieben sind (Hg. Freddy Langer, Prestel Verlag, 144S., geb., 34,95 EUR). Mit seiner »Chronofotografie« hatte der französische Physiologe ein Verfahren entwickelt, um rasche Handlungsabläufe zu zerlegen und zusammen auf ein Bild zu bringen. Er ließ sich vom Interesse des Wissenschaftlers leiten, einen wirklichen Vorgang so genau wie möglich ins Bild zu bringen. Den ästhetischen Reiz seiner Arbeiten, den Verfremdungseffekt, erkannte er nicht.
Wer über die Lüge redet, denkt dabei an die Wahrheit. Denn die Lüge ist die Maske der Wahrheit - ihre Nachtseite. Wo die Wahrheit verkommt, verkommt auch die Lüge. Das wusste schon Oscar Wilde in seinem Text: »Über den Verfall des Lügens«. Denn jede Lüge lebt von Erfindungskraft. Und wo die fehlt, geht es nicht nur der Lüge schlecht, sondern auch der Wahrheit. Gut zu lügen ist eine Kunst - darum Sache des Künstlers, der sich eigene Fantasiereiche schafft. Die werden als Reich der Möglichkeiten zur Wahrheit über die Wirklichkeit.
In den Tagebüchern Julien Greens lese ich den am 7. Februar 1931 notierten Satz: »Die Wörter bilden eine Art Strömung, gegen die man unverdrossen anschwimmen muß; wer nachgibt und sich von ihr mittragen lässt, steuert geradewegs auf das Scheitern zu, denn wenn man lange die Wörter mißbraucht hat, kann man mit ihnen nicht mehr die Wahrheit sagen.«
Die Wahrheit ist nichts, was einfach da wäre und über den Ladentisch des Interessenkampfes geschoben werden kann als Bekenntnisware zum Tagespreis. Wahrheit ist auch nichts, was man sich anlernt, nichts, wozu man sich bekennen kann oder sich mal schnell überreden lässt wie zu einem neuen Waschmittel. Vor allem deshalb nicht, weil man sie immer noch gar nicht kennt, weil man sie suchen gehen - und sich dabei auf die Wörter verlassen können muss. Denn Wahrheit ist das, was in den Worten wohnt. Wer aber die Worte erst einmal billig zu verschleudern begonnen hat, dem verschließen sie sich. Auch dem doppelten und dreifachen Bemühen wird es dann nicht gelingen, den ursprünglichen Zauber zurück zu gewinnen.
»Der Wahrheit nachsinnen - / viel Schmerz«, dieser Trakl-Vers verwundete Franz Fühmann schwer. Aber nicht an der Schwere der Worte, die dem eigenen Sündenfall folgten, starb er, sondern daran, wie leicht andere sie nahmen. Fühmann hatte in der NS-Wochenzeitung »Das Reich« debütiert und wurde dann eifriger Sänger des neuen Menschen im Sozialismus - bis er an den Punkt kam, wo er wusste: Will er die Worte nicht verlieren, muss er aufhören, mitzulügen im Namen einer höheren Wahrheit.
Fühmann wurde zum Bekenner, wie ihn die DDR-offizielle Bekenntnisindustrie nun gerade nicht wollte: einer, der seinen Schmerz ausstellte. Verlorene Illusionen - sind heilsam, wenn man ihretwegen nicht aufhört nachzudenken. So eröffnet sich auch ein neuer Blick auf das Geschwisterpaar Wahrheit und Lüge.
Es bleibt eine Konstante: Wer die Wahrheit okkupiert wie ein Eroberer, der endet als Glaubens-Inquisitor, als Vollzugsbeamter einer sich mit dem Vorrecht auf Wahrheit kostümierenden Gewaltherrschaft. Denn wer die Wahrheit nur für sich haben will, der braucht den Feind, dem er die Lüge zuschieben kann. Die katholische Kirche braucht(e) die Ketzer, um zu wissen, wer sie ist. Denn Institutionen konstituieren sich über Ausschluss, sie ertragen nicht, dass ihre Wahrheit angezweifelt wird. Dabei entsteht Wahrheit nur durch den Zweifel, durch die denkend offen gehaltene Möglichkeit ihres Gegenteils. Darum sind Institutionen (Parteien!) strukturell wahrheitsunfähig. Sie sind nützlichkeits- und interessengelenkt, was völlig legitim ist, solange man es nicht mit der Frage nach Wahrheit und Lüge verwechselt.
Der Berliner Philosoph Steffen Dietzsch hat in seiner »Kleinen Kulturgeschichte der Lüge« (Reclam Leipzig) gezeigt, wie unter Stalin die Bilder der in Ungnade Gefallenen verschwinden mussten. Ganze geschwärzte Bildergalerien. Dietzschs Fazit: »Die große Selbsttäuschung begleitete dann die verschlungenen Wege des Niedergangs jener Emanzipationstheorie.«
Ist es nun besser geworden, seit uns die anstrengende Frage nach Wahrheit und Lüge massenkulturell als Lachnummer um die Ohren fliegt? Bringt ein liberal-infantiles Laissez-faire ein mehr an Freiheit oder bekommt die Spenglersche Kulturkreislehre nun doch das letzte Wort: Ade Abendland, Ausverkauf der Werte und aus? Hannah Arendt hat in ihrer Schrift »Wahrheit und Lüge in der Politik« (1972) die Konstante benannt: »Lügen scheint zum Handwerk nicht nur des Demagogen, sondern auch des Politikers und sogar des Staatsmannes zu gehören. Ein bemerkenswerter und beunruhigender Tatbestand.«
Nicht, dass jemand lügend sich einen Vorteil zu verschaffen versucht, ist das Skandalon, sondern, dass die traditionellen Wahrheitsprüfinstrumente - Parlamente, Medien, Akademien - ihre öffentliche Kontrollfunktion gänzlich zu verlieren drohen. Gibt es bald gar keine unabhängig-kritischen Foren mehr?
Dietzsch konstatiert: »Die Lüge tritt jetzt selbstbewußt und offensiv aus den geheimen Korridoren der Macht heraus. Wir erleben und erleiden in diesem 20. Jahrhundert die Verschmelzung von Öffentlichkeit und Lüge.«
Die Frage nach Wahrheit und Lüge also geht an die Fundamente unseres Selbstbildes. Die Feststellung von Julien Green, wer die Worte zu lange missbraucht habe, werde schließlich unfähig, die Wahrheit zu sagen, ist die Angstvision eines Schriftstellers. Es ist nicht die Angstvision eines Politikers oder Managers - das sollte uns Angst machen.
Ist es denn überhaupt noch ein Skandal, wenn Politiker lügen? Ein Skandal entstünde, wenn sie plötzlich anfingen, die Wahrheit zu sagen. Es gibt keine Lüge mehr in der medialen Massengesellschaft, weil es keine Wahrheit mehr gibt. Es gibt Kalküle, Nützlichkeitsabwägungen, Machtinteressen, virtuelle Räume - aber keine Wahrheit. Nicht einmal mehr die Frage nach ihr. Und darum verflacht auch die Lüge. Wenn wir von niemandem mehr anderes erwarten als eine Lüge, dann wird sie ganz unerheblich.
Die Worte aber haben ein eigenes Gedächtnis, und ihr Missbrauch entfaltet eine eigene Art von Terror, das sollten wir aus Victor Klemperers »LTI« gelernt haben.
Wenn wir also die Frage nach der Wahrheit als einer begrifflichen Anstrengung (Wortarbeit!) wieder so ernst nehmen wollen, wie es unserer Lage angemessen erscheint, dann müssen wir, so paradox es klingt, uns ihr über ihre subversive Seite nähern: die Rechtfertigung der Lüge. Denn die Lüge als bewusste Hervorbringung des Einzelnen delegitimiert die faule Wahrheit, die es sich bequem macht bei den Mehrheiten, die sagt, was wollt ihr, ich bin doch demokratisch korrekt, mir kann keiner. Diese Gewohnheitswahrheit der Allgemeinplätze wird zur Lebenslüge einer Demokratie, wo als Demokrat schon gilt, wer den kleinen Katechismus des Gutmenschentums beherrscht. Diese Konformität unter der Oberfläche des Nonkonformen ist dann das Ende aller Demokratie, die den starken, urteilsfähigen Einzelnen fordert.
Die Wahrheit maskiert sich, wenn sie etwas zu riskieren hat, meint Steffen Dietzsch. Er umkreist das Thema auch in seinem neuen Buch »Wider das Schwere - Philosophische Versuche über geistige Fliehkräfte« (Edition Humboldt). Wer nach der Lüge fragt, der ist auf der Suche nach der g a n z e n Wahrheit, die mehr ist als ihr schöner repräsentativer Schein. Denn die Wahrheit wirft auch hässliche Schatten, die sie gern verbergen würde. Nietzsche hat die Selbstinszenierung der Wahrheit durchschaut. »Was ist Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen.«
Dietzsch philosophiert am Rande der akademischen Philosophie, denn er ist jemand, der zu viel kann, um ihn ganz in der Versenkung verschwinden lassen zu können, aber zu sehr von seiner Ost-Biografie geprägt ist, um ihn über den Status eines Gast- und Vertretungsprofessors hinauszuheben. Das ist auch eine Wahrheit über unsere Universitäten, die sich gern Masken aufsetzt. Aber Dietzsch gefällt sich durchaus in der Position (die hier keineswegs Pose ist) des akzeptierten Außenseiters. Darum kann er auch den Satz ganz unbefangen hinschreiben, die Philosophie beginne, wo der Respekt aufhöre.
Was wird hier aus der Vernunft des Einzelnen, die immer zuerst vitale Überlebens-Klugheit ist? Sie geht ins »Exil der Heiterkeit«, wie es Odo Marquard nennt. Steffen Dietzsch: »Das Lachen ist damit in gewisser Weise das empirische Modell dessen, was abstrakt die Vernunft heißt.« Münchhausen, der Lügenbaron, ist ein Schöpfer seiner eigenen Welt - ein Virtuose im Reich des Möglichen. Ein wiederzuentdeckendes Fossil. Ein nicht zu manipulierender Patriot im Reich der Fantasie, letzter Statthalter des Humanen - und sei es auf dem Mond.
Es ist der ewige Narr, der vor Herrscherthronen Wahrheiten sagt, die andere an seiner Stelle nicht überlebten. Aber den Narren schützt ein Übermaß an Witz und Fantasie. Er ist frei, mit Wahrheit und Lüge öffentlich so zu spielen, dass etwas entsteht, was so selten geworden ist, dass es heute kaum mehr jemand vermisst: Geist.
An Fühmann wäre zu lernen, nicht nur, dass Wahrheit und Lebenslüge zusammengehören, sondern, dass ohne einen Leidens-Preis, den der Einzelne zahlen muss, Wahrheit nichts wert ist. Das ist mit dem Kantianer-Satz gemeint, alles Wissen müsse durch die Erfahrung gegangen sein. Wahrheit zum Nulltarif bleibt beliebiger Allgemeinplatz oder ein selbstgerechtes Moralisieren ohne jeden Erkenntniswert.
Wenn Nietzsche sagt: »Die Lüge ist die Menschenfreundlichkeit des Erkennenden«, dann liegt darin etwas, was Wahrheit und Lüge aus dem abstrakten Gegensatz herausreißt: Irrtum und Enttäuschung, Aufbruchseuphorie und Melancholie - es ist ein Fließgleichgewicht, aus dem Leben gemacht ist. Aber ohne die Frage nach der Wahrheit darin gibt es kein zunehmendes Selbstbewusstsein, das nichts mit der taffen Dreistigkeit von Selbstvermarktung zu tun hat, sondern der wachsenden Einsicht in Wahrheit und Lüge des e i g e n e n Lebens. Nur im Spannungsfeld von Wahrheit und Lüge wächst Urteilskraft.
Eine Lüge der pluralistischen Massengesellschaft ist, dass sie das Gewicht von Wahrheit unzulässig verringert. Wahrheit liegt scheinbar offen. Dennoch bleibt Verstehen erstens eine konzentrierte Anstrengung des Bewusstseins (Arbeit!) und zweitens eine zu erlernende Kunst. Die Scheidung von Wahrheit und Lüge wird zum langwierigen, irrtumsreichen und immer vorläufigen Prozess.
Vor allem Kriegszeiten sind eine Drohung für jeden Münchhausen. Hier wird die Lüge alltäglich und ordinär. Münchhausens Lügen aber sind eine spielerische Form der Selbstvervollkommnung - sie stärken das Immunsystem von Kultur. Die Staatslüge aber ist wie die Staatswahrheit: schwerfällig und ohne Witz. Dem freien Geist ein Gräuel. Ein Schweijk, ein Till Eulenspiegel, ein Nasredin - all diese Fantasten verteidigen den zivilen Witz, sie nehmen jene, die immer nur die Wahrheit zu sagen vorgeben, beim Wort - und schon stehen diese Würdenträger der repräsentativen Wahrheiten da als servile Gewohnheitslügner.
Der schwierige Weg ist immer der bessere. Er setzt auf den Einzelnen und seine Fähigkeit, geistige Erfahrungen zu machen, ein Bewusstsein seiner selbst auszubilden - und damit Urteilskraft zu erlangen. Das wäre der Bürger, der seinen Staat erhält, ohne ihm die Lügen des Apparats abzukaufen. Der frei genug ist, über die Idiotien von Staatsbürokratie zu lachen - denn Lachen über augenfällige Dummheit ist die Freiheit des Geistes, der reicher ist an Möglichkeiten als unsere verwaltete Wirklichkeit.
Denn erst, wenn der Staat besser lügt als seine einzelnen fantasiebegabten Bürger, erst dann ist es wirklich um uns geschehen, leben wir ganz in einer Orwellschen Inszenierung.