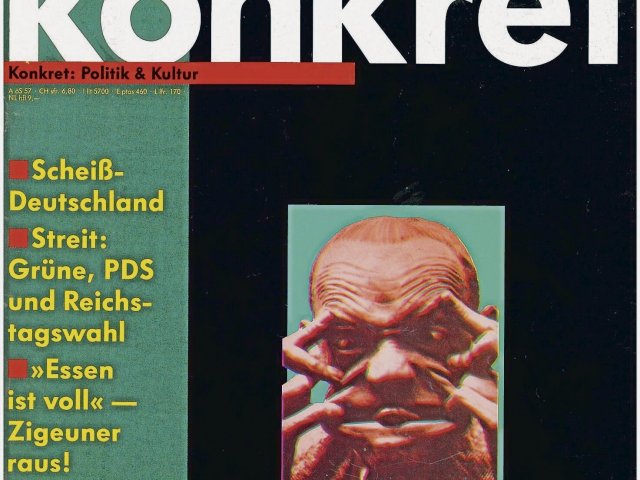Als Design noch Formgestaltung hieß
Ausstellung »gebrauchs gut« über DDR-Design beginnt am 21. November im Leipziger Grassimuseum
Günter Höhne ist Designfachmann durch und durch - seit 25 Jahren beschäftigt er sich als Essayist und Kritiker mit der Entwicklung von Design. Unter anderem war er Chefredakteur der Designfachzeitschrift »form + zweck«. 1993 bekam er den Bremer Preis für Designpublizistik. Tätigkeiten als Juror bei Designwettbewerben, als Fachhochschuldozent, freier Journalist oder als Ausstellungskurator lassen nicht zu, dass Günter Höhne die Beine hochlegt. Das will er auch gar nicht.
Viele haben als erstes gefragt, was das kosten würde.
Zwei Jahre lang reiste er für die Ausstellung »gebrauchs gut« durch die neuen Bundesländer, auf der Suche nach den einst erfolgreichen Unternehmen, die zum Teil heute noch weiter bestehen. Waren diese gefunden, musste er eine Menge Überzeugungskraft aufbringen, die Unternehmen zum Mitmachen zu bewegen. »Viele waren skeptisch und haben als erstes gefragt, was das kosten würde«, erzählt Höhne. Um ihnen die Transportkosten zu ersparen, hat er die Exponate häufig selbst abgeholt. Zudem spürte Günter Höhne jene Designer auf, die DDR-Alltägliches entworfen hatten. »Das war wie eine archäologische Puzzlearbeit, herauszufinden, wer was gemacht hat. Produktgestalter blieben in der DDR eher anonym«, sagt er.
Eine seiner »Bittstellerreisen« führt ihn an einem sonnigen Herbstmorgen auf das Gelände der Sprela AG im Lausitzstädtchen Spremberg. Gemeinsam mit zwei Ausstellungsgestaltern aus Leipzig hofft Kurator Höhne, dass sich das Unternehmen, das zu DDR-Zeiten fast alle Oberflächen mit mehr oder weniger dekorativem SprelaCart verkleidete, auf der Ausstellung präsentiert. Sein größter Wunsch wäre es, wenn die Sprela AG die Ausstellungspodeste mit ihren Erzeugnissen ummanteln würde. Bei Kaffee und Keksen trägt er seine Idee dem Vorstandsvorsitzenden Siegfried Zabel vor.
Das Unternehmen ist der älteste Laminathersteller der Welt. 1925 begann die Produktion von Kunstharzhartpapier und -gewebeplatten. 1989 arbeiteten 1400 Menschen im VEB Sprela - SprelaCart wurde in viele Länder exportiert. Nach der Wende kam auch hier der große Zusammenbruch. Zwar begann 1995 die Laminatproduktion, aber eigentlich arbeiteten die letzten 70 Mitarbeiter nur noch auf Sparflamme, bis eines Tages der Unternehmensberater und Abwicklungsexperte Siegfried Zabel vor ihnen stand und sagte: »Ich bin Ihr neuer Chef.« Er hatte sich entschlossen, das Unternehmen zu kaufen.
Heute hat die Sprela AG 140 Mitarbeiter, davon 20 Lehrlinge, produziert jährlich fünf Millionen Quadratmeter Laminat und exportiert in 42 Länder. Es gebe heute weltweit keine einzige Ikea-Küche mehr zu kaufen, die keine SprelaCart-Arbeitsplatte hätte, sagt Zabel nicht ohne Stolz. Er hält nichts von Nostalgie, weiß aber um die emotionale Bedeutung der Unternehmensgeschichte. Er ist schnell bereit, sich an der Ausstellung »gebrauchs gut« zu beteiligen. Gemeinsam wird in den zahlreichen Mustermappen gewühlt, Ideen schwirren durch den Raum.
Günter Höhne steigt wieder in sein Auto. Uhren aus Ruhla müssen abgeholt werden, Mikroskope aus Rathenow, aus Bad Liebenwerda kommen Reiss-Büromöbel, Montagemöbel aus Hellerau, Glas aus Jena. Höhepunkte der Ausstellung sind u.a. Motorräder: die Zschopauer MZ ETZ 150 und MZ 1000 S. Als Günter Höhne Anfang November wieder einmal nach Leipzig fährt, um sich vor Ort über den Stand der Vorbereitung zu informieren, treibt ihm der Anblick eines Objektes Freudentränen in die Augen. »Über tausend Irrwege ist es mir gelungen, eine künstliche Niere aus dem Zwönitzer Messgerätewerk aufzutreiben«, ist er stolz. Das medizinische Gerät habe heute noch Weltmarktqualität. Er sieht das Gerät durch seine »Designeraugen«, so mancher Dialyse-Patient wird weniger Freude beim Anblick dieser Apparatur empfinden.
Die meisten der Exponate stammen jedoch aus Höhnes umfangreicher Privatsammlung. So hat er nach eigener Aussage inzwischen mehr alte Omega-Staubsauger als die Firma selbst. Jedes Stück hat er liebevoll restauriert, aber nicht renoviert, wie er betont. »Die Gegenstände werden nicht geschminkt, sie sollen ihre Geschichte erzählen.« Plaste-Eierbecher in Huhnform oder ähnlichen Ostkitsch wird der Besucher bei »gebrauchs gut« vergeblich suchen. »Die Exponate haben den Anspruch, intelligent und langlebig zu sein«, sagt Höhne. Herausragende Designleistungen sollen honoriert werden. Weil es viele der Traditionsunternehmen heute noch gibt, sieht er sein Projekt auch als wirtschaftsfördernd an.
Allerdings förderte die Wirtschaftspolitik die Ausstellung keineswegs. Trotz mehrfacher Anfrage haben die Wirtschaftsministerien in Leipzig und Berlin keinen Cent beigesteuert. Hauptsponsor ist die Ikea-Stiftung. Sabine Epple, Kustodin im Grassimuseum, hat alle in Frage kommenden Stiftungen abgeklappert und schließlich lange mit dem Geschäftsführer der Ikea-Stiftung, Peter Tacacs, gesprochen. Der war schnell begeistert, fördert seine Stiftung doch vorrangig Wohnkultur. Zudem war Ikea für die DDR ein wichtiger Exportkunde. So wurde z.B. im VEB Polstermöbelwerk Güstrow in den 80er Jahren für Ikea produziert. Im VEB Möbelkombinat Berlin entstanden sogar die berühmten Billy-Regale. Da Ikea auf die Verpackung druckt, woher das Produkt stammt, gab es bei den Kunden oft Irritationen. »Vor 25 Jahren rümpften die Westkonsumenten die Nase bei DDR-Produktionen. Sie trauten der Qualität nicht«, sagt Tacacs. Dabei ist heute der einzige deutsche Lampenlieferant für das schwedische Möbelhaus ein ostdeutsches Unternehmen: Der VEB Metalldrücker Halle verlegte sich in den 60er Jahren von der Heizlampenproduktion auf Metallleuchten, die ungeahnte Verkaufserfolge und Designpreise einheimsten. In den 70er Jahren entdeckte Ikea die Lampen auf den Leipziger Messen, und so hingen in der ersten deutschen Ikeafiliale bei München 1974 ostdeutsche Leuchten über bayerischen Kundenköpfen. Die Treue des Unternehmens als Auftraggeber rettete die Halleschen Metalldrücker auch nach der Wende über die Privatisierung hinaus.
Noch heute werden dort die Aluminiumschirme und auch das beliebte Campingtopfset hergestellt.
Die Sächsische Kulturstiftung kauft derzeit Stück für Stück die Sammlung von Günter Höhne und integriert sie später in die ständige Ausstellung über deutsche Designgeschichte. Eine erste Anzahlung von 7500 Euro liegt vor. Für jahrelanges Sammeln und zwei Jahre intensive Ausstellungsvorbereitung ein Witz, doch Günter Höhne fragt nicht nach dem Geld. Es liegt ihm persönlich am Herzen, die Kontinuität der Gebrauchsgüter aus dem Osten zu zeigen. »Viele Produkte sind kaum bekannt, weil den Unternehmen das Geld für Marketing fehlt«, sagt er. Zudem bedauert er, dass sich nur wenige jenseits der Ostalgie ernsthaft für DDR-Produkte interessierten. »Und das waren meistens Wessis«, sagte er. Zu ihnen gehört die Hildesheimer Kunstwissenschaftlerin Bettina Becker. Sie warnte vor dem Vergessen ostdeutscher Designleistungen. Das Wissen über Produkte und Gestalter aus der DDR sei erschreckend gering, sagte Becker, als sie Ende Oktober in Chemnitz ein vergleichendes Forschungsprojekt von Design in Ost- und Westdeutschland vorstellte.
Die gute alte westdeutsche Wissenschaft bemüht sich aus eigener Kraft um die Rettung der DDR-Designgeschichte ...
Verwunderlich ist, dass Fachmann Günter Höhne zu der Projektvorstellung nicht eingeladen wurde, geschweige denn daran mitarbeitet. »Vermutlich kennt Frau Becker nicht einmal mein Buch«, so der Publizist. Für ihn ist das »ein weiteres typisches Beispiel, wie die gute alte westdeutsche Wissenschaft sich aus eigener Kraft um die Rettung der DDR-Designgeschichte bemüht, ohne Hinzuziehung der Eingeborenen«, wie er sagt.
Dank vieler privater Spender, der Unterstützung von zahlreichen Unternehmen und Sponsoren kann Günter Höhne nun seine geschichtliche Aufarbeitung ostdeutschen Designs mit Tradition in Leipzig ausstellen. SprelaCart wird der Besucher leider nur bei den exponierten Küchen finden - die ehrgeizige Idee, die Podeste mit Sprela-Laminaten zu verkleiden, scheiterte letztlich am Aufwand und den Kosten. Enttäuscht ist Günter Höhne auch von den Design-Hochschulen in Berlin, Potsdam oder Weimar, die sich in für ihn zu geringem Umfang oder gar nicht in die Ausstellung einbrachten. »Gerade von der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee kamen viele namhafte Formgestalter, wie Jürgen Peters.« Dieser hatte 1958 den Fotoapparat »Pentina« entwickelt, der als erstes Ergebnis einer Design-Diplomarbeit in Serienproduktion ging.
»gebrauchs gut« zeigt etwa 300 Produkte, die in acht Themenwelten gruppiert sind. Ob »wohn traum«, »zeit blick« oder »spiel spaß« - bei allem anti-ostalgischen Anspruch sind Wiedererkennungseffekte und ein Schwelgen in Erinnerungen auch erwünscht. Momentan laufen noch die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren, und Günter Höhne erlebt ständig neue Überraschungen. So hat er gerade erst bei seinen letzten Recherchen für die Exponattexte herausgefunden, dass es die Mifa-Fahrräder nach wie vor gibt. Ein Telefonat und eine E-Mail später ist ein nagelneues Klapprad der Mitteldeutschen Fahrradwerke Sangerhausen für die Ausstellung organisiert, das neben dem ersten, in Berlin verkauften Modell stehen wird. »Ist das eine Aufregung«, stöhnt Höhne nicht unglücklich und macht sich auf den Weg nach Leipzig.
»gebrauchs gut« vom 21. November 2003 bis 29. Februar 2004 im Grassimuseum Leipzig, das zur Zeit der Renovierung im Museum für Kunsthandwerk Interim ist: Neumarkt 20, 04109 Leipzig. Öffnungszeiten: Di, Do-So: 10-18Uhr, Mi: 10-20Uhr, Eintritt 4 EUR (erm. 3 bzw. 2)
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.