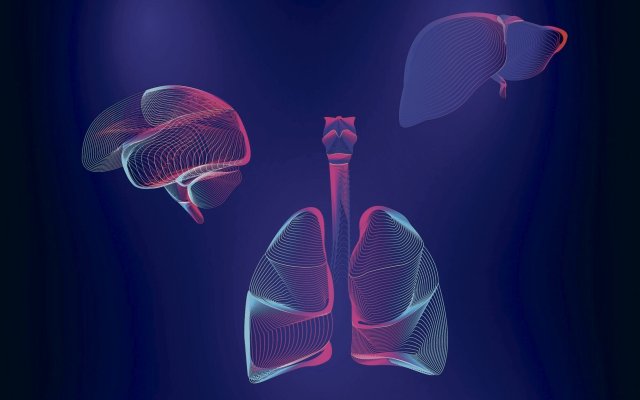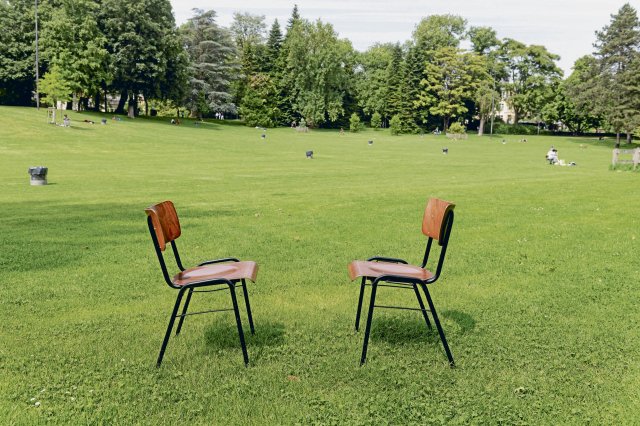Glanz und Elend von INTERKOSMOS
Vor 25 Jahren startete der erste, vor drei Jahren der letzte Gemeinschaftssatellit Von HORST HOFFMANN
Knapp drei Monate nach der historischen Mondlandung der Amerikaner und einen Tag nach dem sich sieben sowjetische Kosmonauten in drei Raumschiffen zu einem Gruppenflug formierten, startete am 14. Oktober 1969 von Kapustin Jar (Krauthügel) an der Wolga, der erste Gemeinschaftssatellit der sozialistischen Staaten INTERKOSMOS 1. Auf dem ältesten Kosmodrom der UdSSR wehten die Fahnen der neun beteiligten Länder; Bulgarien, DDR, Kuba, Mongolei, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn. Zehn Jahre später trat Vietnam dem Programm bei. Der Forschungssatellit IK-1 (Erdnähe 260 km, Erdferne 640 km, Umlaufzeit 93,4 min, Bahnneigung 48,4 Grad) diente dem. Studium der Polarisation solarer Röntgenstrahlung und den Erscheinungen in derürdischen Hochatmosphäre. Die Bord* gerate stammten aus der UdSSR, der CSSR und der DDR.
Die kosmische Kooperation IN-TERKOSMOS begann mit ihren Aktivitäten relativ früh. Ihre völkerrechtliche Gründung erfolgte 1967 mit der Ratifizierung des gemeinsamen Programms durch die einzelnen Länder - zehn Jahre nachdem der erste Sputnik das Raumfahrtzeitalter eröffnete und drei Jahre nach der Konstituierung der (West-)Europäischen Weltraumforschungsorganisation ESRO und der (West-)Europäischen Trägerraketenentwicklungsorganisation ELDO, die in den siebziger Jahren mit dem ESA-Programm ihre Fortsetzung fanden. INTERKOSMOS war die globale Antwort des Ostblocks auf die regionale westeuropäische Initiative, umfaßte sie doch Länder Europas, Asiens und Amerikas.
Die Hegemonie der Sowjetunion kam darin zum Ausdruck, daß alle gemeinsamen Weltraumunternehmen der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Strategie des Kreml untergeordnet waren. So erteilte z.B. der „große Bru-
der“ der kleinen DDR keine Genehmigung für den gewinnträchtigen Export ihrer Multispektralkamera MKF 6, obwohl ausländische Kunden in den Hotels von Jena mit Koffern voller Schweizer Franken darauf warteten. Die „Multispektakelkamera“, wie der Volksmund sie wegen der übertriebenen Propaganda nannte, war bis weit in die achtziger Jahre hinein ein international begehrtes Spitzengerät mit militärischer Relevanz.
Gemessen an den begrenzten technischen und industriellen Potenzen der meisten Partner und der eher hemmenden Geheimhaltung, erzielte die trikontinentale Zehnergemeinschaft erstaunliche Erfolge. Immerhin waren drei Mitglieder - Mongolei, Kuba und Vietnam - ausgesprochene Entwicklungsländer; zwei weitere - Bulgarien und Rumänien - gehörten zu den schwach entwickelten Ländern Europas. Hinzu kam, daß die „kleinen Brüder“ an der kurzen Leine Moskaus lagen und die ge-
samte Gemeinschaft unter dem starken Druck des Embargos für High-Tech-Erzeugnisse aus dem Westen stand.
Dennoch führte INTERKOS-MOS in den 22 Jahren zwischen 1969 und 1991 mehr als 125 Weltraummissionen mit Höhenraketen und Raumflugkörpern durch; davon 25 mit /Ä'-Gemeinschaftssatelliten und 100 mit sowjetischen Flugkörpern. An Bord arbeiteten etwa 600 Geräte und Instrumente aus demPartnerländern»“ der Sowjetunion. „Made in GDR“ waren 167 Bordgeräte bei 78 Missionen. Sieben Typen von Raketen und 20 verschiedene Raumflugkörper der UdSSR kamen dafür zum Einsatz. Die Finanzierung erfolgte nach dem Prinzip: Jeder Teilnehmer trägt die Kosten für den eigenen Beitrag, und die Sowjetunion stellt Startplätze, Trägerraketen, Raumflugkörper und Bahnverfolgungsanlagen kostenlos zur Verfügung.
Moskau gewann durch die Kosmoskooperation Know how auf dem zivilen und militärischen Sektor. So flössen in die sowjetischen Weltraumwaffensysteme die beachtlichen Potenzen solcher Staaten wie DDR, CSSR und Ungarn ein. Von Seiten der DDR geschah dies auf folgenden Gebieten: Feinmechanik und Optik, Bildsignalübertragung und digitale Bildverarbeitung, optische und Infrarot-Zielsysteme, Regelungstechnik und Optoelektronik. Das Kombinat Mikroelektronik nahm eine Schlüsselstellung in der Entwicklung schneller Mikrochips für das sowjetische Raketenabwehrprogramm ein.
In einem Zeitraum von nur drei Jahren - 1978 bis 1981 -, nahmen „Interkosmonauten“ aus allen zehn Ländern an bemannten Unternehmen teil und führten zwei Monate lang 200 diverse wissenschaftliche und technische Experimente an Bord der Orbitalstation SA-LUT 6 durch. Der Tscheche Wladimir Remek und der Pole Miroslaw Hermaszewski flogen wohl vor allem aus aktuellen politischen Rücksichten der Sowjetunion zuerst. Untftn: der Zurücksetzung litt die Partei- und Staatsführung der DDR so sehr, daß sie für den Flug von Sigmund Jahn als dritten Mann, sogar den hohen Preis der kostenlosen Übergabe der MKF 6 an die UdSSR zahlte.
Seit 1976 startete kein bemanntes Raumschiff mehr in Baikonur ohne Geräte aus den Partnerländern. In den Achtzigern standen komplexe Experimente im Vordergrund, bei denen kombiniert unbemannte und bemannte Raumflugkörper, Forschungsraketen, -flugzeuge und -schiffe zum Einsatz kamen; Gobi 1981, Schwarzes Meer 1983 und 1985; Ghyunesh 1984 sowie GEOEX und Wasserreservoir 1986. In dieser letzten Phase der Zusammenarbeit erfolgte auch eine Beteiligung an sowjetischen und internationalen Tiefraummissiqnen wie VENERA, VEGA und PHOBOS. Der letzte gemeinsame Start von IK-25 am 31. Dezember 1991 diente der Plasmaforschung. Doch zu diesem Zeitpunkt war INTER-KOSMOS bereits ebenso sangund klanglos untergegangen wie der RGW
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.