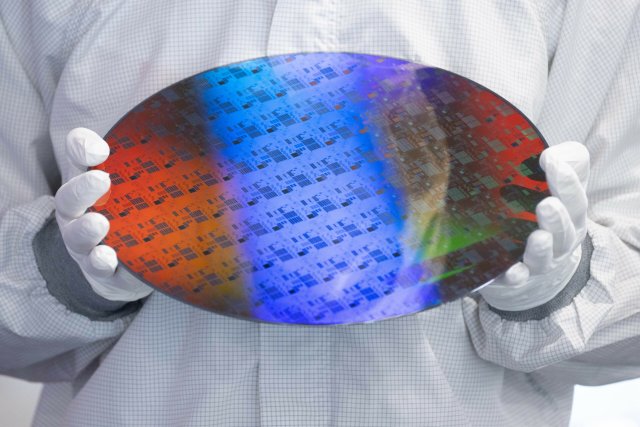Japan: Das Prinzip lebenslanger Anstellung bröckelt
Mit dem Ende der Wirtschaftsdynamik steht heute die ganze Beschäftigungspolitik auf dem Prüfstand
Von Dr. HEINER WINKLER
Ein Report macht derzeit in Japan Furore. Er stammt von der Tokioter Filiale der prominenten US-Agentur Moody's, weltweit bekannt durch ihre Meßziffern (Indices) zur Entwicklung von Weltmarktpreisen, etwa von Rohwaren. Moody's bewertet u. a. auch namhafte Firmen in der Welt auf ihre Kreditwürdigkeit und hat dabei soeben japanische Großunternehmen rüde runtergestuft. Zur Erklärung heißt es, die von ihnen praktizierte „Anstellung ihrer Stammbelegschaft auf Lebenszeit“ mindere in dieser Phase flauer Wirtschaftsentwicklung spürbar die Konkurrenzfähigkeit der Gesellschaften. Für sie wird mithin Leihgeld teurer als früher.
Nun hat das System, Personal lebenslang anzustellen, in Japan eine sehr lange Tradition. Jobs sind dabei zu einer Art Eigentum geworden: Häufig gehen sie vom Vater auf den ältesten Sohn über. Damit verbindet sich die eigentümliche Loyalität zwischen Belegschaften und Kapitalmagnaten, jene fast familiäre Beziehung, die unterschiedliche Interessenlagen verschleiert. Der Arbeitnehmer wird sozusagen zum Sohn des Fabrikherrn und dankt ihm die unkündbare Stellung mit Anspruchslosigkeit, Fleiß, Sorgfalt, Leistungsund Qualitätssteigerung, damit die Firma prosperiere.
Moody's enthüllt nun eine Kehrseite der Medaille: Da gibt es Stahlunternehmen, die wegen der Umsatzflaute bran-
chenfremde Fertigungen aufziehen. Dort stellt überschüssig gewordenes Personal wenig kostengünstig Speicherchips oder Nahrungsmittel her, was nach Moody's eine „unwirtschaftliche Kapitalverwertung“ bedeutet. In der Chemieindustrie hätten der höheren Effizienz wegen etliche Unternehmen fusioniert, doch weil man am Personalstand im wesentlichen festhalte, seien die Kosteneinsparungen nur gering.
Es gibt indessen auch Beispiele, daß lebenslange Anstellung in Japan bereits aufgehört hat, ehernes Prinzip zu sein. Die Werften etwa, denen überseeische Konkurrenz (Südkorea!) das Wasser abgräbt, haben teilweise ihr Personal bis um 80 Prozent abgebaut. Auch Textilfabrikanten
trennten sich mitunter von der Hälfte ihrer Belegschaften.
Moody's räumt zugleich ein, daß es im Gegensatz zu Stahl, Chemie, Zement, Textil, Bankgewerbe oder Airlines wichtige Zweige gibt, denen die Lebenszeit-Beschäftigung weiter satte Kostenvorteile bringt - so die Elektronik- und Automobilindustrie.
Statistisch hat in Japan die Erwerbslosigkeit noch immer wenig Gewicht. Die betreffende Rate ist derzeit in der BRD mindestens viermal so hoch. Dabei muß man Japans eigentümliche Betriebsstruktur im Auge haben: Volkswirtschaftlich das Sagen haben nur 300 bis 400 Großunternehmen; in erster Linie gilt das Prinzip lebenslanger Anstellung. Neben dem Stammpersonal, das dieses Privileg genießt und den produktivsten Teil der Konzernbelegschaft bildet, gibt es Beschäftigte, die nur befristet, ohne Vertrag im Betrieb arbeiten, in der Hoffnung, irgendwann in den Stamm überführt zu werden. Dazu kommt eine Riesenzahl kleinerer Betriebe, unter denen die „Familienbetriebe“ dominieren. Sie sind für Sony, Toyota, Toshiba usw. in der Regel direkt oder indirekt Unterauftragnehmer Die
„Großen“ stützen sich also auf ein fast unübersehbares Geflecht billiger Zulieferer mit Erst-, Zweit- und Drittverträgen und einem Heer von Beschäftigten, vorzugsweise Mitglieder von Großfamilien, die häufig nicht zur Lohnarbeiterschaft zählen. Sie partizipieren am Firmeneinkommen als Angehörige des Clans, in den sie fest eingebunden sind. Diese Zulieferer sind für die Konzerne Konjunkturpuffer, sind mal weniger, mal mehr beschäftigt. Doch in der Arbeitslosenstatistik schlägt sich diese Fluktuation kaum nieder Selten nur gehen mitarbeitende Familienmitglieder reguläre Arbeitsverhältnisse ein.
Ohne Zweifel bröckelt diese spezifische Art von Gesellschaftskontrakt. Jüngere Menschen haben die Zwänge des patriarchalisch ausgerichteten Familienclans satt. Sie wollen nach eigenem Geschmack leben. Es zieht sie weniger als zuvor in die Industrie. In der rasch expandierenden Dienstleistungssphäre ist Arbeit oft leichter und interessanter.
Auch sind viele des alten Entlohnungssystems überdrüssig, das nicht nach dienstlicher Verantwortung, Art der Beschäftigung, beruflichen
Fertigkeiten fragt, sondern nach den Jahren der Betriebszugehörigkeit. Jüngere Jahrgänge sind erbärmlich unterbezahlt. Mitarbeiter Ende 40 bis Mitfe 50 beziehen dagegen, auch wenn ihre Arbeitskraft bereits nachläßt, das höchste Gehalt in ihrem Berufsleben. Die Diskrepanz zwischen unteren und oberen Lohngruppen beträgt dabei etwa das Sechsfache jenes Abstands, der im Durchschnitt in der BRD zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten üblich ist. Die Lohndiskriminierung gerade von Jahrgängen mit dem größten Leistungsvermögen ist zweifelsfrei ein massiver Unternehmensvorteil, zumal für etliche der Mitarbeiter ja das Privileg relativ hoher Bezahlung nach langer Betriebszugehörigkeit aus gesundheitlichen Gründen am Ende nur ein schöner Traum bleibt.
Trotzdem: Das System, als langjähriges, erfahrenes Belegschaftsmitglied nicht nur großen Respekt, sondern auch ein entsprechendes Einkommen zu genießen, ist nach Moody's in der japanischen Gesellschaft sehr tief verwurzelt. Deswegen bezweifeln die Experten, daß es bald zum alten Eisen geworfen wird.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.