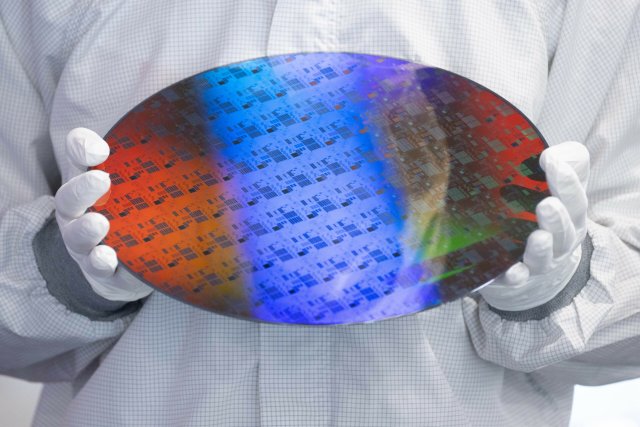Städte und Gemeinden brauchen mehr politische und finanzielle Spielräume - sie müssen zum einen mit ihren Bürgern sowie der Wirtschaft und zum anderen mit den Nachbar-Kommunen kooperieren. Das ist das Fazit des II. Nationalen Städtebaukongresses dieser Tage in Bonn.
Mehr als 76Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung wohnt in Städten. Deren Erhalt und Entwicklung ist für Bundesbauminister Manfred Stolpe (SPD) von entscheidender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wie er kürzlich auf dem II. Nationalen Städtebaukongress sagte. Stolpe verwies auf das seit Ende April geltende neue Baugesetzbuch. Mit diesem würden Umweltbelange und Mitwirkungsrechte der Öffentlichkeit gestärkt, das Baurecht vereinfacht sowie die Instrumente des Stadtumbaus und der Sozialen Stadt in das Gesetz integriert.
Das war auch dringend nötig. Dass schrumpfende Städte kein allein ostdeutsches Problem mehr sind, darauf verwies in Bonn Helmut Holter (PDS), Vorsitzender der Bauministerkonferenz sowie Bau- und Arbeitsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Auch westdeutsche Städte spürten bereits deutlich die Wirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen. Dies bedeute, Stadtgefüge mit kurzen Wegen und langen Öffnungszeiten zu schaffen, mit kleinen Verwaltungen und kreativen Freiräumen. Holter sprach sich für eine »Abrisskultur« aus. Der Stadtumbau sei mit dem Thema Baukultur zu verknüpfen, damit schrumpfende Städte von den Bürgern angenommen würden.
Holter plädierte wie andere für eine engere Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit der Wirtschaft. Dabei müsse die Wirtschaft akzeptieren, dass die demokratisch legitimierte Vertretung der Öffentlichkeit der Seniorpartner ist. Allianzen mit der Wirtschaft dürften nicht zu Lasten der Bürgerbeteiligung gehen. Ob für den Anspruch, dass die Kommune der Herr des Verfahrens in der Stadtplanung und bei der öffentlich-privaten Kooperation bleibt, rechtliche Vorschriften allein reichen, bleibt fraglich. Notwendig sind eine Finanzausstattung, die den Kommunen ihre Handlungsfähigkeit zurückgibt, kompetente kommunale Verwaltungen und vor allem eine engagierte Bürgerschaft.
Dennoch: Das Kräfteverhältnis zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft verschiebt sich immer weiter zu Gunsten der Unternehmen. Während Kommunen unter Finanznot, Bevölkerungsrückgang und Arbeitslosigkeit leiden, verweisen vor allem große Unternehmen auf ihre fehlende Standortbindung. Zwangsläufig wächst die Konkurrenz zwischen den Städten und Gemeinden. Herbert Schmalstieg, Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Hannover, plädierte dementsprechend für eine enge Kooperation vor allem zwischen Kernstädten und Umlandgemeinden.
Kontroversen gab es auf dem Kongress um diverse Förderprogramme. So stünden noch immer Zuschüsse für den Wohnungsneubau (Eigenheimzulage) sowie für den Wohnungsabriss aus dem Stadtumbauprogramm Ost in den Kommunen nebeneinander. Wolfgang Kunz, Stadtplanungsamtsleiter in Leipzig, verwies darauf, dass in Leipzig 14Prozent der Wohnungen nach 1989 gebaut wurden. Viele davon seien nicht bedarfsgerecht und verschärften die Leerstandsprobleme.
Raum zu bieten für das Wohnen, ist die wichtigste Funktion der Städte. Deswegen wird aus Sicht von Lutz Freitag, Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungsunternehmen, der bestehenden Stadt und ihren Wohnquartieren künftig mehr Aufmerksamkeit zu widmen sein als dem Neubau. Dazu gehörten Wohnumfeldverbesserungen und das soziale Quartiersmanagement. Noch immer werden übrigens täglich in der Bundesrepublik 105 Hektar Boden neu in Anspruch genommen. Dies ist zwar weniger gegenüber den 130Hektar im Jahr 2000, aber bei rückläufiger Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung auch kein Ruhmesblatt, wie Achim Großmann (SPD), Staatssekretär im Bundesbauministerium, feststellte. Das habe mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung wenig zu tun.