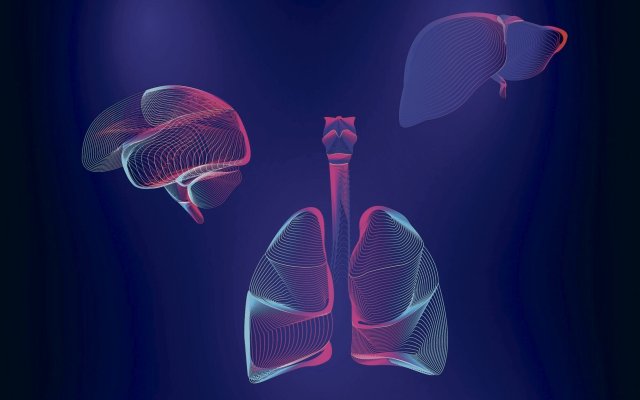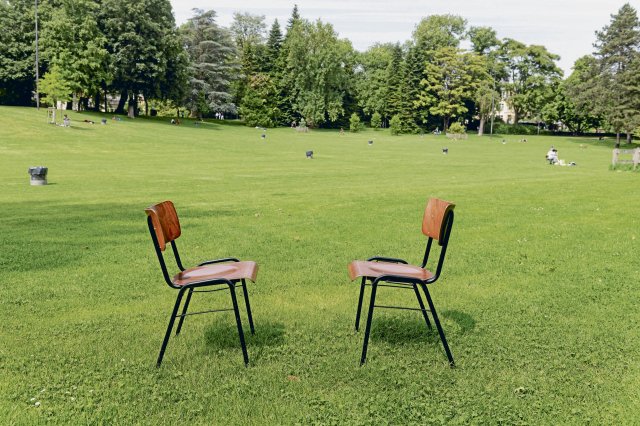Antisemitismus in der DDR? – Fakten und Fiktionen
„Zwischen Repression und Toleranz. Die SED-Politik und die Juden“ - ein Vortrag nebst Diskussion
Von REINHARD PITSCH
„Zwischen Repression und Toleranz. Die SED-Politik und die Juden“ hieß das Thema eines Vortrags von Dr. Mario Keßler, zu dem der Forscher- und Diskussionskreis DDR-Geschichte kürzlich in die Räume der Berliner „Hellen Panke“ eingeladen hatte. Der Referent wollte der DDR fluchen, mußte sie aber segnen, je mehr er sich an das historische Material hielt.
Da wäre zunächst die augenfällige Differenz zu den Westzonen bzw zur BRD, wo 1949 noch ganze 300 nationalsozialistische Täter inhaftiert waren und wo Nazis in die Regierung kamen. Ganz anders der antifaschistische Neubeginn in der Sowjetzone.
Keßler räumte ein, daß bis 1949 jeder Antisemitismus in der KPD bzw SED verpönt war und wies auf die begrüßenden Stellungnahmen zur Gründung Israels hin. Erst am 7.11.1949,
ein Jahr nach der antisemitischen Repressionswelle in der UdSSR, hat der Vorsitzende der Zentralen Kontrollkommission der SED, Herbert Matern, alle Landeskontrollkommissionen aufgefordert, die Schweizer Emigration auf „zionistische“ oder „jüdisch-trotzkistische“ Kontakte zu überprüfen und Juden als solche zu kennzeichnen. Bis Mai 1953 wurden alle Parteimitglieder aus westlicher oder jugoslawischer Emigration oder jüdischer Herkunft überprüft.
Mehr Belege für Antisemitismus in SED und DDR konnte der Referent beim schlechtesten Willen nicht anbieten. Kein „Bruderland“ hat den stalinistischen Antisemitismus weniger übernommen als die DDR.
Ende 1952 hätte eine „Fluchtwelle“ der jüdischen Gemeinde aus der DDR eingesetzt, bis 30. Mai 1953 seien 550 Juden geflohen. Ohne Be-
zug zu der allgemeinen Übersiedlungswelle in die BRD aus ökonomischen und politischen Gründen bleibt die These von einer „Fluchtwelle“ gerade der Juden fragwürdig.
Das der Antisemitismus in der DDR selektiv, auf politisch Mißliebige oder Unbequeme gerichet war (Paul Merker), wurde von Keßler auch deshalb zugestanden, weil 1953 Bezirksgerichte in Frankfurt/ Oder, Gera und Magdeburg Angeklagte verurteilten, die jüdische Mitbürger beschimpft hatten. Vor allem aber gab es 1953 während der Arbeiterdemonstrationen keinerlei antisemitische Äußerungen oder Parolen - sehr im Gegensatz zu den Ereignissen in Polen und Ungarn.
Für die Zeitspanne 1956-1967 konstatierte der Referent, daß die „Säuberung“ der Intelligenz, konkret: die Prozesse um die „Harich-Gruppe“ und der Weggang (jüdischer) Pro-
fessoren wie Ernst Bloch, Hans Mayer und Leo Kofier ebenfalls keinerlei antisemitischen Hintergrund hatten. Es hätte eine deutliche Differenzierung von Antisemitismus und Antizionismus gegeben, Juden konnten in der DDR sicher leben. Das Verhältnis zu Israel wurde auch vom BRD-Alleinvertretungsanspruch (Hallstein-Doktrin) beeinflußt, den die DDR-Diplomatie aushebeln wollte. So gab es 1956/57 inoffizielle Kontakte in Moskau, eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen scheiterte an der israelischen Forderung nach 500 Millionen US-Dollar
Nach dem 6-Tage-Krieg 1967 wurden aus Polen 25 000 Juden vertrieben, darunter auch Leopold Trepper, der Chef der „Roten Kapelle“, ein Vorgang, der in der DDR undenkbar gewesen wäre.
Leider wies der Referent nicht auf den rechten, nämlich nietzscheanischen Ursprung
der antisemitischen Phrase von den „jüdisch (trotzkistischen)“ Radikalen/Bolschewiken/Vaterlandsverderbern hin: Georges Sorel differenzierte bereits 1920 in einer Schrift „Pour Lenine“ (Für Lenin) den Russen und Wohltäter Lenin von den für Hunger, Bürgerkrieg und Repression verantwortlichen Juden Trotzki und Radek - Stalin mußte diese Denkfigur bloß aufnehmen.
In der Diskussion wurde empört die Behauptung des Vorsitzen des Zentralrates der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, korrigiert, daß das Gedenken an die „Reichskristallnacht“ am 9 November in der DDR „verboten“ gewesen sei. Ein Blick in die Spalten von DDR-Zeitungen - zum Beispiel von „Neues Deutschland“ - belegt das Gegenteil. Aber offenbar muß, im Sinne der Totalitarismustheorie, auch im Bereich des Antisemitismus eine Kontinuität vom Dritten Reich zur DDR erfunden werden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.