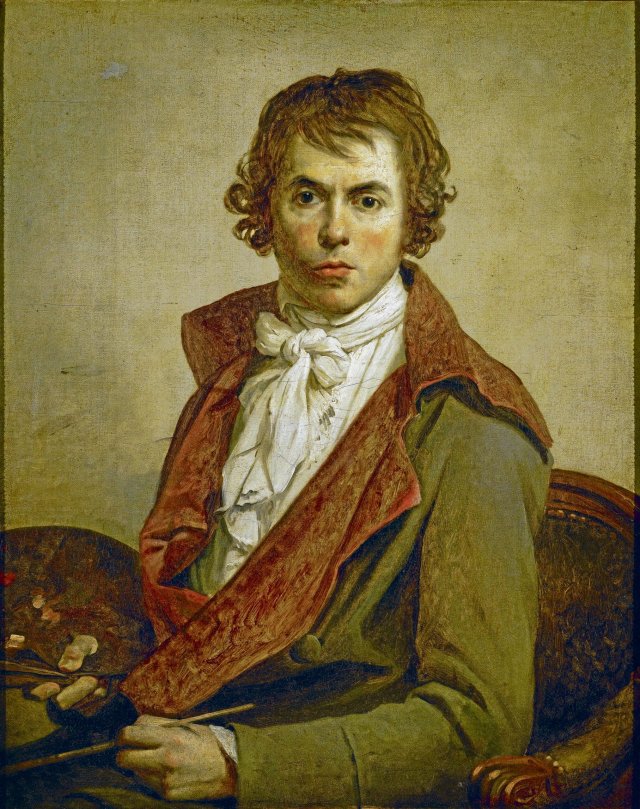- Kultur
- JUDISCHE ZUWANDERUNG AUS RUSSLAND
Der Punkt im Sowjet-Paß
Ein halbes Jahrhundert nach dem Völkermord wandern Juden wieder nach Deutschland ein. Sie kommen aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die meisten von ihnen aus Rußland. Irene Runge beschreibt die jüdische Zuwanderung zwischen 1989 und 1994.
Die Leser erfahren von jüdischem Leben in Rußland und anderen sowjetischen Republiken, vom „fünften Punkt“ im sowjetischen Paß, wo Juden unter der Frage nach der Nationalität „Jewrej“ einzutragen hatten. Sie lesen von Assimilation und Anderssein, von der Suche nach jüdischer, religiöser und nationaler, Identität. Irene Runge berichtet aber auch über DDR-Alltag, über den eigentlich nicht vorhandenen Umgang mit nationalen
Irene Runge: „Ich bin kein Russe“ Jüdische Zuwanderung zwischen 1989 und
1994. Dietz Verlag Berlin
1995. 184 S., Br., 8 Abb., 24,80 DM.
Fragen, verbreitete Unkenntnis über Juden und Judentum. Nach „Wende“ und „Anschluß“ kommen Juden wieder in dieses Land. Sie und auch die Deutschen haben Schwierigkeiten mit'der nöüen Wirk 1 lichkeit,“ /nit,, dem. Loben irn. neuen Lande. Viele der immigrierenden russischen Juden sind noch auf dem Wege, ihre jüdische Identität zu finden: Obwohl als „Jude“ registriert, lebten und empfanden sie wie andere sowjetische Bürger, selbst dann noch, wenn sie in ihrer alten Heimat offener oder
versteckter Diskriminierung ausgesetzt waren. Waren sie nach sowjetischem Nationalitätengesetz „Jude“, wenn der Vater Jude war, so gelten sie nach jüdischem Gesetz nur als solche, wenn die Mutter jüdisch ist - ein Konflikt ergibt sich hieraus bei dem Wunsch nach Aufnahme in die deutsche jüdische Gemeinde.
Irene Runge versteht es, ihren Lesern die komplizierten Sachverhalte verständlich zu machen; Fünf Gespräche 'mit Betroffenen illustrieren dieses neue Kapitel jüngster deutscher Geschichte. Im Interesse des Abbaus von Mißtrauen und Fremdenfeindlichkeit möchte man dem Buch weite Verbreitung wünschen.
WOLFH. WAGNER
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.