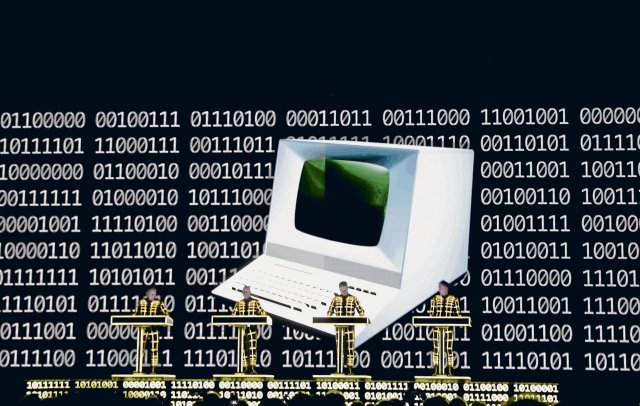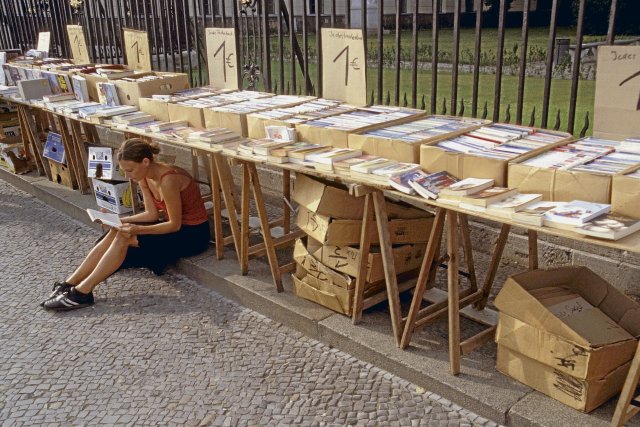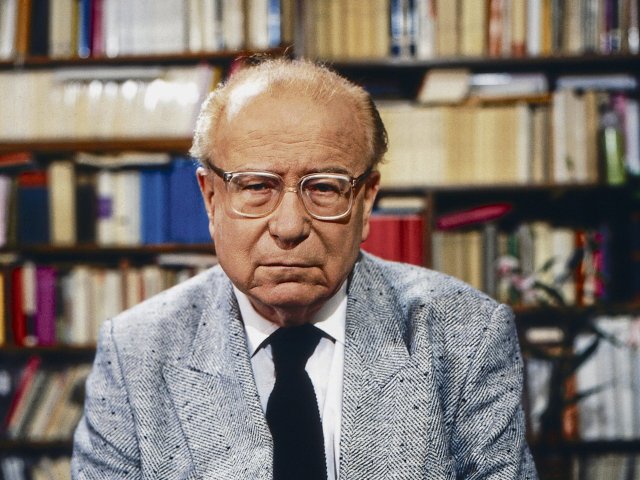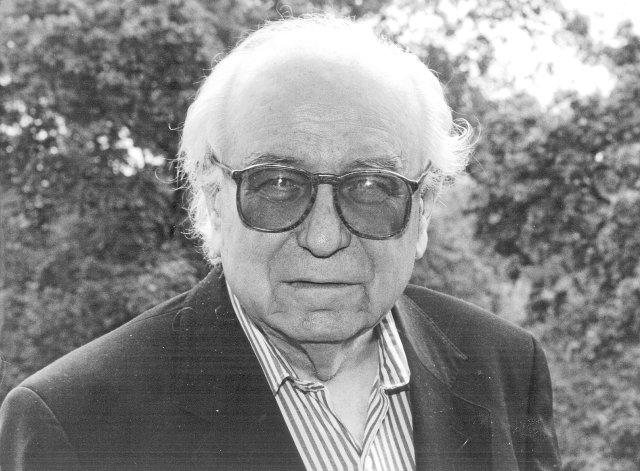- Kultur
- Eine grandiose Schau in Speyer: Leonardo da Vinci als Künstler, Erfinder und Wissenschaftler
Das Automobil mit Uhrwerksantrieb
Triebfeder einer Uhr, Federzeichnung, um 1495 Foto: Katalog
Einen Steinwurf vom gewaltigen romanischen Kaiserdom Speyers entfernt liegt das Historische Museum der Pfalz. Seit Anfang August bot es rund 250 000 Besuchern eine Begegnung der höheren Art: die Ausstellung „Leonardo da Vinci - Künstler, Erfinder, Wissenschaftler“ Es war eine Sisyphosarbeit, das Ausstellungsgut für diese Exposition zu organisieren. Keine Galerie, keine Sammlung oder Bibliothek der Welt trennt sich gern von einem so kostbaren Schatz wie einem Original von Leonardo da Vinci. Selbst die Arbeiten seiner Schüler und die aus seiner Werkstatt sind mittlerweile unbezahlbar.
Sicher, dem geheimnisvollen Lächeln von „La Gioconda“, die wohl besser unter dem Namen „Mona Lisa“ bekannt ist, kann man hier nicht begegnen. Zum Original-Erlebnis dieses Bildes kommt man auch weiterhin nur in den heiligen Hallen des Louvre. Und das berühmte Fresko des Abendmahls im Mailänder Kloster Santa Maria delle Grazie ist nicht weniger mühevoll zu erreichen und nur vor Ort zu betrachten.
Es ist schon wahr, daß mit dem Namen Leonardo da Vinci die populäre Vorstellung von unvergänglichen Meisterwerken der italienischen Renaissance-Malerei verbunden ist. Die Mona Lisa ist gewissermaßen zu Leonardo da Vincis Markenzeichen geworden. Und doch steckt in seinem Werk mehr als bloße Kunst. Es ist ein Verdienst der Organisatoren dieser Schau, daß sie nicht zur Vertiefung der Mythenbildung um das Malergenie Leonardo da Vinci beitragen, sondern klar und nüchtern darstellen, auf welch viel-
fältigen Gebieten sich dieses wahrhafte Universalgenie, dieser Prototyp des Renaissance-Menschen, erprobte und bewährte.
Wenn dabei fast ausschließlich auf Reproduktionen seiner kostbaren Originale zurückgegriffen wurde oder Schülerund Werkstattarbeiten aufgeboten werden müssen, dann tut dies weder dem Informationswert noch dem Schauwert Abbruch. Das Profil-Porträt einer jungen Frau von 1495-97 oder die Madonna in der Felsengrotte von 1510, das der Werkstatt zugeschrieben wird, geben auf ihre Weise Auskunft über die Arbeitsmethode des Künstlers. Auffällig sind jeweils die vollendete Raumgestaltung, die die Figuren in ihrer plastischen Körperlichkeit betonen, und die ansatzweise erkennbare malerische Modellierung, die eine rauchartige Farbatmosphäre, das sogenannte Sfumato schafft.
Die Zuschreibungen an Leonardo da Vinci oder an seine Werkstatt sind außerordentlich schwierig. Noch vor hundert Jahren rechnete man mit etwa 100 eigenhändigen Gemälden, davon ist nach modernen Analysen gerade ein Zehntel übriggeblieben. Der „Rest“ wurde dem Umfeld zugeordnet, was insofern nicht schlimm ist, da auch von Schülern ausgeführte Werkstattarbeiten in der Renaissance selbstverständlich stets die Formgesinnung des Meisters verraten. Lediglich der Grad der Vollkommenheit läßt die Unterschiede ermessen.
Hinzu kommt die Eigenart der Arbeitsweise Leonardos, der seine Arbeiten oft unvollendet ließ, wenn er das jeweilige künstlerische Problem für
sich geklärt hatte („Anbetung der Könige“, 1481). Hier gibt es fraglos Parallelen zum Werk des Bildhauers Michelangelo, der nicht minder perfekt die Kunst des Non finito, des Unvollendeten, beherrschte. Um
die rastlose Suche nach Erkenntnissen in Natur und Wissenschaften seiner Zeit richtig einzuordnen, muß man sich vergegenwärtigen, daß für Leonardo das künstlerische Bild in höchster Vollendung al-
les Wissen seiner Zeit umfassen sollte.
Es liegt auf der Hand, daß hier in Speyer auch der wissenschaftliche Anatom ins Blickfeld gerückt wird, der als einer der ersten in der Neuzeit Leichen sezierte, um sich über den Zusammenhang von Skelett, Muskulatur und Organen ein genaues Bild zu verschaffen. Mit welcher Gründlichkeit der Künstler dabei vorging, wird beim genaueren Hinschauen deutlich. Die Knochen- und Muskelmänner scheinen uns heute sicher weniger sensationell, wir sollten bei ihrer Betrachtung aber nicht vergessen, daß Leonardo zu den mutigen Menschen gehörte, die nach den Jahrhunderten tiefsten Mittelalters einen Schritt aus dem Dunkel des Glaubens in die Welt des Wissens wagten.
Das gilt übrigens auch für seine vielfältigen Studien zu mathematischen, vor allem aber geometrischen Fragen und für seine ingenieurtechnischen Erfindungen und Visionen. In diesem Teil erreicht die Ausstellung sicher den höchsten Schauwert für das Publikum, denn eine Reihe seiner nur in Zeichnungen überlieferten Konstruktionen wurden für diese Schau als Modell nachgebaut. So ist denn Leonardo hier als Konstrukteur eines ersten Automobils greifbar, das freilich noch mit einem mechanischen Uhrwerksantrieb auskommen mußte. Ferner sind seine Funktionslösungen für Dreh- und Klappbrücken oder für Schwerlastkräne ausgestellt.
Höchst modern wirkt auch sein Prinzipentwurf für ein Schaufelradschiff - eine renaissancehafte Vorwegnahme
unserer heutigen Wassertreter. Wichtige, rein empirische Erkenntnisse zum alten Menschheitstraum des Fliegens stammen ebenso aus Leonardo da Vincis Werkstatt. Bereits 1495 (!) entwickelte er zum Beispiel einen funktionstüchtigen Fallschirm. Die kriegerische Epoche an der Wende zwischen Mittelalter und Neuzeit hatte freilich nicht nur friedliche Aufgaben für Leonardo. Er entwarf nicht nur Sakralbauten und Idealstadtgrundrisse und Verteidigungsanlagen. Gleichermaßen versuchte Leonardo auch mit recht respektablen Waffenentwürfen die Förderer seiner Kunst zu überzeugen. Er schuf den ersten „Panzer“ der Neuzeit sowie Orgelgeschütze, die man zu den Vorläufern moderner Geschoßwerfer rechnen kann.
Ein kleiner Exkurs ist dem Verhältnis von Albrecht Dürer zu Leonardo da Vinci als Künstler und Entdecker gewidmet. Gerade Dürer hat ja wie kein anderer die Erfahrungen der italienischen Renaissance studiert und für die deutsche Kunst des 16. Jahrhunderts produktiv gemacht. Es ist gut, daß man hier in Speyer darauf verzichtet hat, Dürer in ein Quasi-Schüler-Lehrer-Verhältnis zu Leonardo zu setzen. Er bleibt der selbständig fragende jüngere Zeitgenosse, der das Werk des anderen kennt und achtet, aber aus anderer Tradition den Weg zum gleichen Ziel sucht.
Historisches Museum der Pfalz, Speyer: Leonardo da Vinci-Künstler, Erfinder, Wissenschaftler Bis 19 November, Di-So 10-20 Uhr
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.