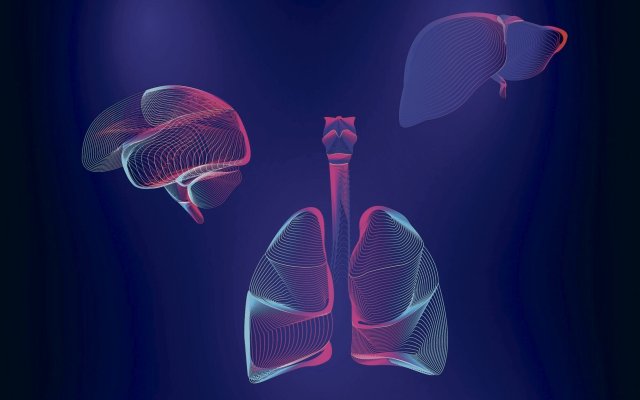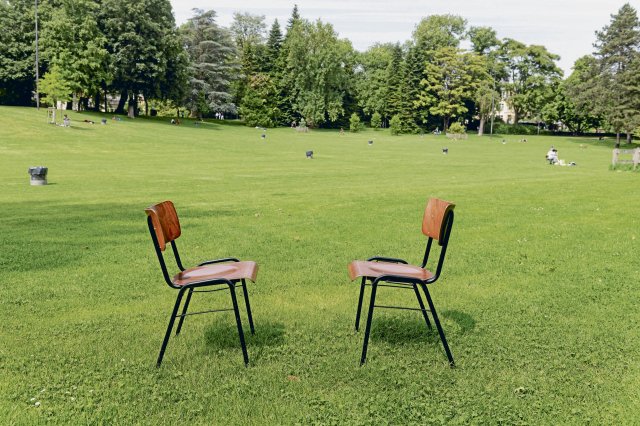Mathe lernen mit Mozart
»Neuroaktive« Musik hilft Schülern bei der Überwindung von Denkblockaden
Begründer dieser Therapie ist der Physiker und Psychologe Günter Haffelder, der sich seit etwa 20 Jahren mit der Frage beschäftigt: Was geht im Gehirn eines Menschen vor, der Lesen lernt, einen schwierigen Bewegungsablauf trainiert oder ein mathematisches Problem löst? Um diese Frage zu beantworten, wertet Haffelder das Elektroenzephalogramm (EEG) der betreffenden Personen aus, wobei sein besonderes Interesse der elektrischen Aktivität des limbischen Systems und damit Hirnprozessen gilt, die beim emotionsbezogenen Lernen eine maßgebliche Rolle spielen. Die dabei gemessenen EEG-Potenziale zerlegt er mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens in ihre einzelnen Frequenzanteile. Aus den so gewonnenen Daten glauben er und die Mitarbeiter seines Privatinstituts, sowohl spezielle Fähigkeiten als auch funktionelle Störungen und Blockaden des Gehirns ablesen zu können.
Tausende von Messungen belegen eines zumindest glaubhaft: Bei Kindern mit Lernstörungen (Lese- und Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche etc.) zeigt das EEG typische Aktivitätsmuster, wie sie bei Kindern ohne Lernhandicap normalerweise nicht auftreten. So fehlen einige Schwingungsmuster des Gehirns bei bestimmten geistigen Übungen ganz oder sind nur schwach ausgeprägt. Häufig ist überdies die koordinierte Zusammenarbeit der beiden Hirnhälften beeinträchtigt. »Um diese Störungen zu beheben«, sagt Haffelder, »versetzen wir das limbische System durch Musik in andere Schwingungszustände.« Denn das menschliche Gehirn besitzt die erstaunliche Fähigkeit, sich rasch auf äußere Frequenzen einzuschwingen.
Dem pflichtet im Grundsatz auch die Bielefelder Neurobiologin Gertraud Teuchert-Noodt bei: »Haffelder nutzt die Plastizität des Gehirns.« Dadurch ist es zum Beispiel möglich, verloren gegangene Hirnfunktionen durch spezielle Anregungen ganz oder teilweise zu regenerieren. Nur leider seien, so Teuchert-Noodt weiter, pauschale Therapiekonzepte bei Lernstörungen oft wenig hilfreich: »Der Erfolg der neuen Methode liegt in der individuell zugeschnittenen neuroaktiven Musik.« Für jeden seiner Klienten lässt Haffelder mithin eine eigene Musik-CD einspielen, die genau an dessen EEG-Profil angepasst ist. Als therapeutisch besonders wirkungsvoll hat sich bisher die Musik von Mozart erwiesen, die jedoch verlangsamt dargeboten und von anderen Geräuschen überlagert wird, etwa von den Schreien eines Delfins oder dem Brummen eines Hubschraubers. Eine solche CD muss der Klient dann mehrere Wochen lang hören, und zwar immer dann, wenn er Aufgaben löst, die ihm nachweislich Probleme bereiten.
Bei etwa 80 Prozent der Menschen könnten auf diese Weise Lernblockaden abgebaut werden, versichert Haffelder und betont, dass seine Therapie nicht auf unergründlichen subliminalen (unterschwelligen) Einflüssen beruhe. Vielmehr würden durch das Hören der neuroaktiven CD verschiedene Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet, die unsere kleine grauen Zellen in erhöhte Lernbereitschaft versetzten.
Auch bei Menschen mit schweren zerebralen Schädigungen, wie sie etwa nach einem Unfall auftreten, wird die neue Musiktherapie mit Erfolg angewandt. Ein Beispiel: Nach einem Schädel-Hirn-Trauma und zwei Jahren Rehabilitation konnte ein Mann lediglich den kleinen Finger der linken Hand bewegen. Alle anderen motorischen Funktionen waren praktisch ausgefallen. In dieser schier hoffnungslosen Situation ließ seine Ehefrau am Haffelder-Institut eine neuroaktive CD erstellen, nach deren Klängen die Therapeuten sowohl die Stimmbildung als auch einzelne Körperbewegungen des Patienten trainierten. Mit Erfolg. Heute kann der Mann wieder sprechen, selbstständig essen und sogar gehen.
»Wer heilt, hat Recht«, lautet Haffelders Credo, das von anderen Wissenschaftlern in dieser Form bekanntlich nicht geteilt wird. Sie bemängeln vielmehr, dass der Stuttgarter Forscher seine Ergebnisse nicht in renommierten Fachzeitschriften publiziere, um sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen. Obwohl Haffelder befürchtet, hinterher von Kollegen plagiiert zu werden, sei diese Kritik berechtigt, sagt Thilo Hinterberger von der Universität Tübingen, der sich als Physiker seit Jahren ebenfalls mit Hirnforschung beschäftigt.
Dass Musik indes auf verschiedene mentale Prozesse einzuwirken vermag, bestreitet er nicht. Im Gegenteil. Musikalische und EEG-Rhythmen seien oftmals sehr ähnlich, weiß der Tübinger Wissenschaftler aus eigener Forschungsarbeit zu berichten. Außerdem beeinflusse Musik nachhaltig unsere Emotionen und löse dabei häufig unerwartete Assoziationen aus. »Ich bin überzeugt, dass auch Lernprozesse durch Musik befördert werden können und sehe prinzipiell keinen Grund, an Haffelders Ergebnissen zu zweifeln«, so Hinterberger. Gleichwohl wünscht er sich einen offenen und fairen Diskurs über die Grundlagen der in Fachkreisen noch wenig bekannten Therapie, nicht zuletzt um zu verhindern, dass die akademische Wissenschaft sich dazu vorschnell in Frontstellung begibt.
Internet: www.haffelder.de; www.gehirnforschung.com
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.