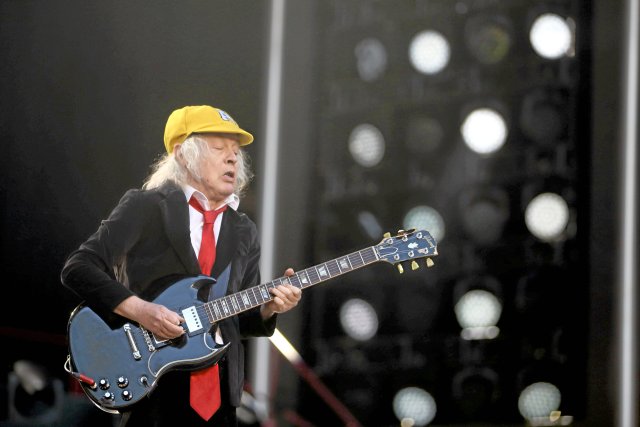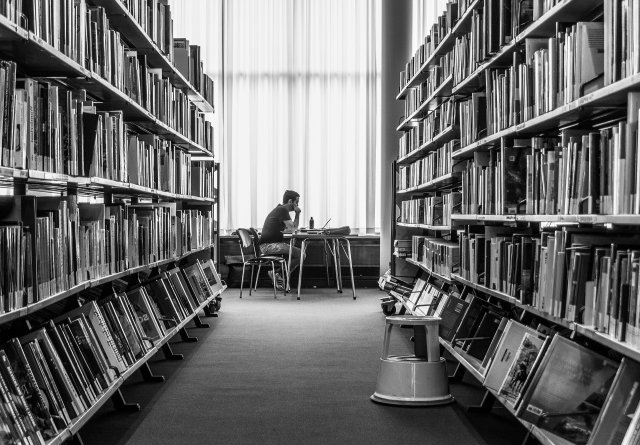- Kultur
- Zum Tode des korrimunistischen Anwalts Götz Berger (1905-1996)
Verfolgt von Freund und Feind
„Juristerei erzeugt Neigung zum Formalismus und erschwert revolutionäres Denken und Fühlen.“ Für Götz Berger, der am 6. März 1996 nach einer Zeugenaussage im „Havemann-Prozeß“ im Gerichtssaal starb, treffen diese Worte des Anwalts Karl Liebknecht wahrlich nicht zu. Er zählte vielmehr zu jener Minderheit von streitbaren Juristen in Deutschland, die auf der Seite derjenigen stehen, für die das herrschende Recht nur allzu oft zum Unrecht gerät. Berger war der letzte noch lebende Anwalt jener legendären proletarischen Rechtsschutzorganisation „Rote Hilfe Deutschlands“ (RHD), die 1921 entstand und sich 1924 reichsweit konstituierte.
Ende der 20er Jahre übernimmt der blutjunge promovierte Referendar, seit 1927 Mitglied der KPD, Verteidigeraufgaben bei solch bekannten RHD-Anwälten wie Joseph Herzfeld, Reichstagsabgeordneter der USPD (später KPD) und Onkel der Herzfeld-Brüder 1932 überträgt ihm die RHD, mittlerweile ist er als Rechtsanwalt zugelassen, eigenständige Mandate. Berger verteidigt nun vor den Strafgerichten Berlins Arbeiter, die in Auseinandersetzungen mit nazifaschistischen Formationen verwickelt waren, versucht mit juristischen Mitteln, Arbeitslose vor ihrer Exmission aus ihren Wohnungen oder Wohnlauben zu bewahren und streitet vor den Arbeitsgerichten für den Erhalt der Arbeitsplätze der von Kündigungen bedrohten roten Betriebsräte. Zwangsläufig zog ein solches Engagement fernab einer bürgerlichen Karriere und ohne sattes Einkommen
1933 ein Berufsverbot wegen Betätigung im „kommunistischen Sinne“ nach sich. Verteidigung von Kommunisten, Entgegennahme von Gebühren seitens der RHD und Spendenleistungen an die RHD lautet die vom Staatssekretär im preußischen Justizministerium, Roland Freisler, unterzeichnete Begründung.
Götz Berger emigriert, kämpft als Interbrigadist im Spanischen Bürgerkrieg, wird in Frankreich interniert und kommt über die britische Armee ins sowjetische Turkmenistan, wo er in einer Seidenfabrik arbeitet. Ostern 1946, also vor genau 50 Jahren, kehrt er in die SBZ zurück.
Ausgehend von den Erfahrungen in der Republik von Weimar und mit der Naziherrschaft will er nun mitwirken am Aufbau einer antifaschistisch und antikapitalistisch reT gulierten Gesellschaft und ihrer Justiz. Er arbeitet u.a. in der Justizabteilung im Zentralsekretariat der SED, als Dozent an Richterschulen und als Richter und Oberrichter am Stadtgericht Berlin. Natürlich bleibt Berger Ende der 40er/ Anfang der 50er Jahre nicht unbeeinflußt von wirklichen und konstruierten Angriffen auf die DDR, also vom Kalten Krieg, der in jener Zeit ein Nährboden für unterschiedlichste Fundamentalismen ist. So verhängt er als Richter in einigen Strafverfahren Freiheitsstrafen, die bezüglich ihrer Höhe durchaus kritikwürdig sind. Bereits 1956 sieht er es ähnlich. Andererseits spricht er sich zugleich für einen „Einfluß von unten auf die Gerichte“ und für eine Entkriminalisierung von Bagatelldelikten (welch aktuelle krimi-
nalpolitische Forderung!) aus. Er weist die Auffassung, daß jede Straftat (auch eine fahrlässig begangene) ein Werk des Klassengegners sei, als lebensfremd und für einen Sozialisten untragbar zurück und setzt sich unter dem Eindruck des XX. Parteitages der KPdSU für den Ausbau der Beschuldigtenrechte, der Bastion der Rechtsstaatlichkeit im Strafrecht, ein.
1976 ereilt Berger ein zweites Berufsverbot, ausgesprochen vom Minister der Justiz der DDR. Denn der „alte kommunistische Anwalt“ hatte in einem Gutachten rechtliche und politische Bedenken gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns geäußert sowie die Verteidigung Robert Havemanns übernommen. Deshalb ist er auch jetzt als Zeuge vernommen worden. Wohlgemerkt: freiwillig. Denn Berger war zwar gegen eine extensive politische Strafverfolgung, aber begangenes Unrecht sollte ebensowenig unter den Tisch gekehrt werden. Und er wußte, daß sich in den damaligen Vorgängen auch das Defizit an Vergesellschaftung politischer Macht widerspiegelt, das zur Implosion der DDR beigetragen hat.
Diese Erkenntnis zu bewahren, ist wohl ein Vermächtnis Götz Bergers. Daß hingegen das Bundesversicherungsamt seine richterliche Praxis zum Anlaß nahm, ihm 1995 V seine Sonderrechte als Verfolgter des Naziregimes zu entziehen, bestätigt nur Brecht: „Die Deutschen haben überhaupt keinen Sinn für Geschichte, vermutlich weil sie keine Geschichte haben.“
VOLKMAR SCHONEBURG
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.