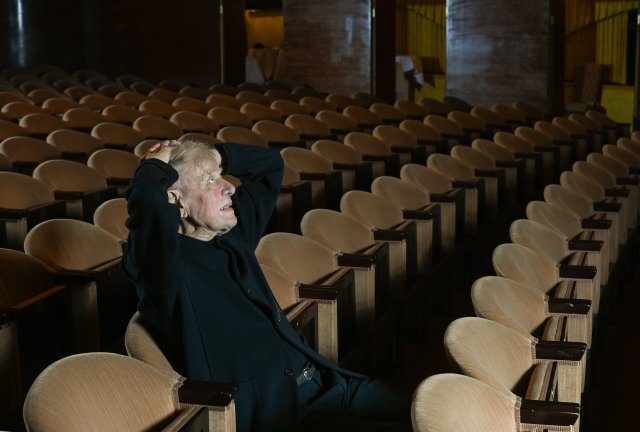»Narrheit, die das Leben ist«
»Die Herkunft der Uhr«: Letzte Gedichte von Rainer Malkowski
Vor dem letzten Gedicht die anderen Gedichte. Über ein kosmisches Wunder: den »Widerschein des Alphabets/ auf einem Gesicht«. Über unsere Stimme, »wenn wir sprachlos sind«. Über Heimatliebe, die im Grund nichts ist »als Angst vor Veränderung«. Über die Fliege auf einem Blatt Papier, »von dem sie nicht weiß,/ daß es ein Brief ist,/ in dem ein Freund beiläufig/ über die Fliegen im Sommer klagt«. Und der Dichter notiert, was er irgendwann noch einmal schreiben wollte: »Ein Spottlied/ über alternde Männer,/die sich zum Narren machen.« Aber auch: »Eine Verteidigungsrede/ für jede Narrheit,/ die das Leben ist.«
Das ist sie: Rainer Malkowskis Ausgewogenheit, seine Gerechtigkeit gegenüber den Zwischenräumen von Gegensatz zu Gegensatz. Die Gedichte sind nicht metaphorisch, sie sind genau. Genauigkeit, so erzählt diese Lyrik, ist nur dann schön, wenn sie das Wahrgenommene nicht vergewaltigt, wenn sie das Geheimnis dahinter nicht antastet. Fast von jedem Gedicht Malkowskis lässt sich sagen, was es unaufgelöst mit sich herumträgt und was einem früheren Band den Titel gab: Verse, »vom Rätsel ein Stück«.
Trotz scharfsinniger Formulierungen dunkeln die Gedichte über ihrer Rätselhaftigkeit ein - und das steht nicht im Gegensatz zur besagten Genauigkeit der Beobachtung. Jeder blühende, windwogende Baum: Dies ist die Feier der Dichter. Und dies ist die Frage der Dichter: Was wissen wir von der Unterseite der Blätter?
Die Rücksicht aufs Unantastbare, die Vorsicht beim Aufdecken hängt bei Malkowski mit einer so leisen wie zugleich sicher gelebten Distanz zusammen. Es ist, als wirke und webe er an einem ganz besonderen Spiel-Raum - an eben jenem Raum, der ihm immer da sein muss. Nicht für die Erfüllung einer bestimmten, ausgewählten Sehnsucht. Sondern Raum für die schöne Bewegung mehrerer Sehnsüchte aufeinander zu.
.......................................................................
FROMMER WUNSCH
Wasser, fließ bergan.
Steine, zerspringt.
Niemals soll kommen
das Ende
der Vorläufigkeit.
HERBSTGANG
Nun steht die Sonne tief.
Man kommt ins Gespräch
mit seinem immer ausführlicher
werdenden Schatten.
Wenig Neues
dabei zu erfahren.
Aber das Alte gewinnt
seine Wahrheit zurück,
daß es einem
die Kehle zuschnürt.
.......................................................................
Die Bilder - von der Welt, von den Menschen, von uns selber - gehen uns dann nicht aus, wenn wir die Rätsel retten. Retten wir sie nicht, kommt es zu dem, was Peter Handke den »Bildverlust« nennt. Jenen Verlust der Fähigkeit, die eigenen Einbildungskräfte gegen die allgemeine Bilderflut zu behaupten. Gedichte ermutigen, sich die Welt mit Bilderblitzen anders zu erfinden, als sie (uns) die tonangebenden Realisten täglich einschüchternd hinwuchten. Es ist lebensspendend, den eigenen Alltag mit Fantasie zu unterwandern, zu übersteigen und Augen zu haben fürs Wesentliche: die Unscheinbarkeit der Unscheinbarkeiten. Ja, die Unscheinbarkeit! Eine Schicksalsmacht. In einem der Verse wird zum Beispiel Post empfangen. Ein Gedicht! Gerade will der Dichter das ihm Zugesandte im Garten lesen, da schiebt sich ihm eine Wolke vor die Sonne. Er schreibt einen Brief: »Wenn Sie wollen,/ schicken Sie mir ein anderes Gedicht./ Für dieses hier/ bin ich als Leser verloren.« Dichters Schicksal: Was er im Schatten der Bäume schreibt, wird in Schatten gestellt von den Bäumen selber.
Also: sich nicht von Wirklichkeit betäuben lassen, aber doch das Wirkliche sehen. Von einer Dachluke aus, etwa, die Sterne. Immer zu wenig Zeit haben wir für den unsteten Blick. »Nicht, was ich nicht weiß,/ reut mich./ Mich reut/ der nachlässige Gebrauch/ meiner Augen.«
Der Autor nannte seine Gedichte selbst einmal »Variationen der Distanz«, er schreibt gegen falsche Nähe. Er ist wie ein Maler, und was ist Malen? Etwas Vages mit den Augen so lange einkreisen, bis aus diesem mehrfach wiederholten Etwas, das vielleicht gar nicht da ist, just das hervortritt, was immer schon da war. Hervortritt mit der Deutlichkeit eines Schmerzes,
Was mich an Gedichten bewegt, ist, so seltsam es klingen mag, ihr Misstrauen gegenüber dem Sprachgebrauch. Wenn Malkowski einmal schrieb: »Wir verstehen uns nicht,/das ist gut«, so war das nicht Lieblosigkeit oder Zynismus, sondern Einsicht: Mit jedem Wort erschweren wir den Zugang zur Wahrheit. »Ein Wort näher/ dem verderblichen Glanz/ jeder Erscheinung./Und schon das nächste/ nicht mehr/zu sagen« (1989). Der Dichter arbeitet dagegen an, alles in Floskeln zu pressen, alles Große kleinzureden, nur um Sprachlosigkeit zu überbrücken.
Siebenjähriger Krieg, gegen den Krebs? Nein. Nur eine unsinnige, leichtfertige Pointe. Rainer Malkowski hat keinen Krieg geführt. Seine Gedichte sind Einübungen in ein Einverständnis. Er offenbart keine Resignationsstufen. Er geht auf das zu, was sterblich hält. Das »Ich« weiß gutartig um seine Relativität. Es muss sich weltwärts erfahren, also in Verwitterung - der aber Schönheit abgewonnen werden kann. An Malkowski perlt somit jene Selbstübertreibungstechnik ab, die das Individuum zu einer so glänzenden, so elenden europäischen Sackgasse gemacht hat. Der Dichter schreibt schmucklos, in seinem Werk lebt er schmucklos, und er existiert als pure deutsche Tradition: Außen ändert sich wenig bis nichts, bis alles Nichts wird - aber innen wird es immer reicher und lebendiger. »Meinen Geburtstag kann ich mir gut/ in einem Bahnhofsrestaurant/ vorstellen: allein.« Auf glückliche Weise verschollen sein.
Nur die Urteilskraft bittet der Dichter am Ende, zu bleiben: »verlaß mich nicht im Nebel der Medikamente, wo die letzte, die gemauerte Einsamkeit beginnt ... Wieviel Chemie verträgt das Wesen aus Chemie? Ich möchte es nicht herausfinden.«
Gedichte liest man gläubig: Erlösung ist möglich. Erlösung vom Gram, dass man immerzu, am Tag tausendmal, fällig wird für die Grobheit. Auch Malkowskis Gedichte erlösen. Man hält plötzlich vieles wieder für möglich und zukünftig. Unzeitgemäßes. Etwa Gespräche zwischen Menschen, in dem kein Platz ist für die Frage: Und womit verdienst du dein Geld?
Rainer Malkowski: Die Herkunft der Uhr. Gedichte. Mit einem Nachwort von Albert von Schirnding. Carl Hanser Verlag München. 95 S., geb., 14,90 EUR.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.