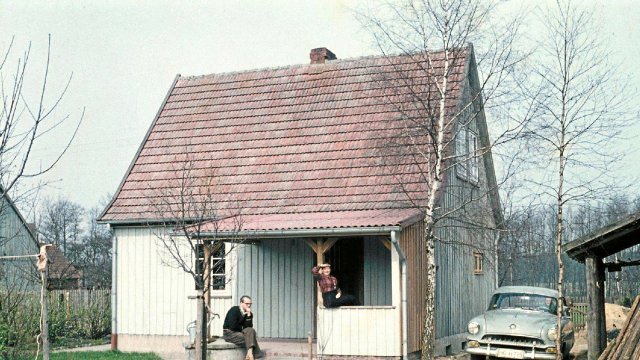Mobbing ist längst nicht mehr nur ein Problem am Arbeitsplatz. Auch in Familien oder in der Nachbarschaft findet der Psychoterror statt - und immer öfter auch an Schulen. Mit gravierenden Folgen, häufig werden betroffene Kinder von Suizidgedanken geplagt. Da der Prozess meist unbemerkt von Lehrern und Eltern beginnt, sollen potenzielle Opfer die Strickmuster erkennen und damit umgehen lernen.
»Es gibt in unserer Klasse zwei Jungs, die sind ein bisschen die Außenseiter und werden von den Älteren oft beleidigt. In der Turnhalle, da wurden sie so richtig geärgert - von allen Jungs.« Emma redet laut und schnell. Das kleine Mädchen mit dem rundlichen Gesicht und dem kleinen blonden Zopf wirkt aufgeregt und engagiert, wie sie so mit Mitschülern der 5. Klasse einer Kreuzberger
Grundschule am Tisch hockt. Sofort pflichtet ihr ein anderes Mädchen bei: »Es ist gar kein Respekt in der Klasse, das geht mit Beschimpfen und so.« Und auch ein Junge mischt sich ein: »Ich habe gesagt, dass sie aufhören sollen.« Die Kinder unterbrechen sich immer wieder gegenseitig - alle wollen diese Geschichte erzählen. Denn obwohl das Ganze schon eine Weile zurück liegt - emotional stecken sie noch mitten drin. Letztlich reißt Emma etwas energisch die Rolle der Erzählerin an sich und beschreibt, wie die großen Jungs aus der siebten Klasse von dem Gedemütigten Handyfotos machen wollten, als er geweint hätte. »Dann
meinten wir, lasst ihn doch in Ruhe, er ist heute schlecht drauf, er ist Außenseiter und so. Und dann haben die zu uns gesagt, wenn ihr nicht aufhört, schlagen wir euch.« Die Kinder liefen daraufhin zum Hausmeister, um Hilfe zu holen. Der zeigte ihnen später, wie sie einen anderen Weg durch die Schule nehmen können, falls sie Angst haben, den Großen wieder begegnen zu müssen.
Während vor Jahren unerfreuliche Kommunikationsformen zwischen Schülern als »normales« kindliches Ärgern, Necken oder Hänseln abgetan wurde, erkennen immer mehr Pädagogen, Eltern und Erziehungsexperten im »Mobbing« schwererwiegende soziale Probleme. Das Wort kommt aus dem Englischen und meint jemanden anpöbeln, wegekeln, solange angreifen, bis das Opfer »freiwillig« geht oder gekündigt wird. Gerade wegen letzterer Definition sucht man das Phänomen am ehesten am Arbeitsplatz. Anzutreffen ist Mobbing aber überall im Alltagsleben: In der Nachbarschaft, in Familien und eben auch an Schulen. Meist subtil, immer im Verborgenen, an Lehrern und Eltern vorbei. Irgendwann leidet ein Kind an Kopf- oder Bauchschmerzen, kann sich nicht mehr konzentrieren, mag schlichtweg nicht mehr in die Schule gehen. Aus Scham, nicht aus eigener Kraft mit dem Problem fertig zu werden und unterlegen zu sein, vertraut es sich nicht mal den Eltern, geschweige denn anderen Erwachsenen an. Das Problem verschärft sich, wenn ehemalige Freunde »das Lager« wechseln oder einfach wegschauen. Die Betroffenen fühlen sich dann endgültig mutterseeleallein.
Sie selbst waren bisher noch nicht direkt von Mobbing betroffen, erzählen Emma und ihre Mitschüler. Gemeinsam mit Gleichaltrigen aus der Weddinger Rudolf-Wissell-Grundschule und mit Erwachsenen hocken sie an einem warmen Herbstvormittag in einer zum Tagungsraum umgebauten Turnhalle am Rande von Berlin und lassen sich über Methoden der
Ausgrenzung und Demütigung informieren - lernen, was sie tun oder lassen sollen. Organisiert hat das Zusammentreffen das Berliner Kindermuseum Labyrinth, das - inspiriert durch Astrid Lindgren - unter dem Titel »Volles Recht auf Spunk und Spiel« noch bis März nächsten Jahres eine ebenfalls ambitionierte Ausstellung zeigt.
In der den fachlichen Teil der Tagung ergänzenden Talkshow »Sag bloß! - Mobbing gibt's schon unter Kindern?« stellt Mitarbeiter Joao Eduardo Albertini mit Heranwachsenden derweil einige typischen Szenen nach, damit jedem klar wird, wo das Problem beginnt - derber Spaß also aufhört. »Wie heißt du?« »Aische.« »Willst du spielen?« »Ja.« »Ich habe aber den Ball!« Das pummelige Mädchen mit dem Ball wählt andere Mitspielerinnen, Aische bleibt allein.
Es seien viele Erinnerungen während dieser Arbeit hoch gekommen, sagt der Brasilianer Albertini, besonders der Ärger auf dem Sportplatz mit älteren Jungs - Schlägereien, zerrissene Klamotten und die vom Vater angedrohte Prügel, wenn er sich nicht endlich zu wehren lerne. Es sei damals für ihn eine regelrechte Zwickmühle gewesen, schüttelt er den Kopf und lacht. Albertini habe viel mit Kindern gesprochen, um ihre Geschichten aufzuarbeiten. So ist er stolz auf seine kleinen Schauspieler, die ihr Bestes geben.
»Bist du die Neue?« fragt ein schick angezogenes Mädchen. »Ja«, nickt das andere mit ärmlicher Bekleidung. »Du stinkst«, rümpft das dritte die Nase, »du hast ja keine richtigen Schuhe an!« »Eine Baby-Jacke!« wetteifert das erste, »kriegt ihr zu Hause nichts zu essen?« Das dünne Mädchen fällt förmlich in sich zusammen. Da kommt das vierte, gibt ihm die Hand »Willst du mit mir spielen?« Kinder applaudieren, die kleinen Darstellerinnen hüpfen zurück zu ihren Klassenkameraden und knien sich auf den Boden nieder.
Walter Taglieber ist einer der Experten, der die Fragen der Kinderrunde beantworten soll. Situationen, wie die gerade Vorgespielte, kenne er in- und auswendig. Es fange alles ganz harmlos an. »Ich sage: Du hast ein schönes Hemd an, ist es aus dem Rot-Kreuz-Container?« Das gesprochene Wort sei nicht angreifbar, aber was zählt und was der andere sofort spürt, sei die Absicht, ihn anzugreifen, sein soziales Ansehen, seinen Status, sein Selbstwertgefühl. Und dann sitzt noch eine andere Person
daneben und lacht über den Spruch. Beim nächsten Mal heißt es: »Holt ihr eure Sachen immer aus dem Rot-Kreuz-Container?« Jemand sagt: »Dusch dich mal«, dann »Geh weg.« Neben dem Angreifer und seinem Opfer gibt es Mitläufer, die sich als Clique definieren, und eine große Zahl von Schweigern, die sich aus Angst oder Gleichgültigkeit nicht einmischen. Nie wegsehen, appelliert Taglieber daher an seine kleine Zuhörer. »Wenn ich sage, schönes Hemd, Rot-Kreuz-Container, kannst du sagen: "Lass ihn in Ruhe, was willst du von ihm?" Und schon habe ich nicht mehr das Gefühl, ein Opfer vor mir zu haben.« Als Opfer, Mitläufer oder gar Täter outet sich erwartungsgemäß keines der hier versammelten Kinder. Sie erzählen überwiegend Geschichten von anderen. Als der kleine Erik wissen will, was er machen soll und kann, wenn er als Unbeteiligter eine Mobbing-Situation erlebt, schnellen Finger in die Luft. »Man versucht, den Streit zu schlichten«, schreit ein Mädchen, »den Klassensprecher holen«, meint ein anderer. »Wenn die mobben, wenn die schlagen, dann auseinander nehmen.« Und alle lachen mit, wenn der Vorschlag »Angreifen« in »Eingreifen« umgewandelt wird.
Samira sagt, sie würde erst zum Lehrer gehen, wenn Jungs sie und andere ärgern, und »wenn der nichts tut, dann rufe ich meinen Vater zur Schule, dann redet er mit denen, dann hören die einige Zeit auf, und dann fangen die wieder an.« »Zu Samira sagen sie immer Schwachkopf«, verrät ein Mädchen. »Wenn man zum Lehrer geht, dann sagen sie: "Petze, du wirst sehen, was passiert." Und dann hat man auch Angst, weil die dann wieder schlagen«, resigniert Samira. »Wenn die mich schlagen, dann schlage ich zurück!« Aische spricht ihre Gedanken laut aus, »aber wenn sie Samira schlagen, dann heult die nur.«
So sehr das Problem vor Jahren verkannt wurde, warnen Experten heute davor, jede gelegentliche Hänselei oder einen Streit als Mobbing zu definieren. Voraussetzung, um von diesem gesellschaftlichen Problem zu sprechen, ist ein Ungleichgewicht der Kräfte zwischen Täter und Opfer und ein Auftreten über einen längeren Zeitraum. Ferner hat sich gezeigt, dass es keine bestimmten Ursachen wie Herkunft, Bildungsgrad, Behinderung oder Neid gibt, die zu Mobbing führen. Und es sind »ganz normale« Kinder und Jugendliche, die an diesem Prozess beteiligt sind. Als Täter fungieren meist diejenigen, die in Gruppen eine Machtposition ausüben, ihre Opfer sind meist körperlich schwach, ängstlich, ruhig und mit geringem Selbstwertgefühl. Ihre soziale Unsicherheit drücken sie oft durch ein ungeschicktes Verhalten aus.
Auch die Erscheinungsformen von Mobbing innerhalb des Schulbetriebs sind verschieden. Mal verschwinden Hefte, werden Schulsachen versteckt oder zerstört, mal wird hinter dem Rücken gelästert, Mitschüler machen Andeutungen oder flüstern, man darf nicht mehr mitspielen oder an der Gruppenarbeit teilnehmen, auch gibt es demütigende Briefe, E-Mails oder Handy-Nachrichten, oder es wird Geld erpresst ... Hilfe kann da nur von Erwachsenen kommen. Allerdings merken die das Problem nur, wenn Betroffene ihre Ängste überwinden und sich aktiv an Lehrer oder an ihre Eltern wenden.
Labyrinth Kindermuseum Berlin, Osloer Str. 12, 13359 Berlin