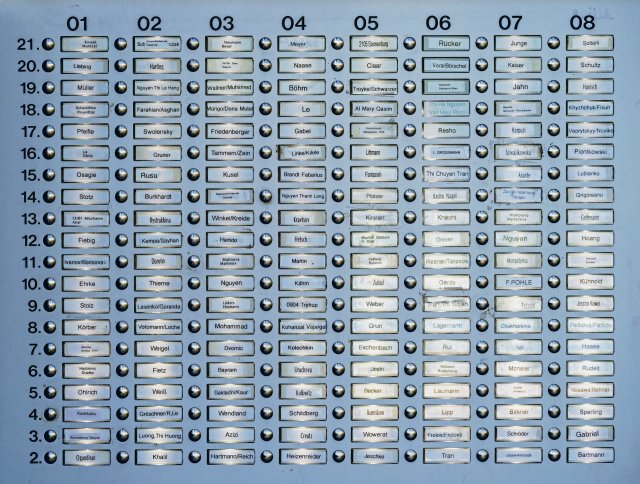Zocken mit Steuergeld wird verboten
Österreich zieht Konsequenzen aus kommunalen Spekulationsskandalen
Wie viel Geld den Bach runter gegangen ist, wissen die Salzburger auch einen Monat nach Auffliegen des Skandals nicht so genau. Die inzwischen gefeuerte Beamtin, die mehr als ein Jahrzehnt hindurch Landesgelder in riskante Finanzgeschäfte investiert hatte, gibt den aufgelaufenen Buchverlust mit 340 Millionen Euro an. Obwohl ein ganzes Team von Experten die Bücher durchforstet hat, konnte der tatsächliche Verlust offiziell bisher nicht verifiziert werden.
Auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz weiß man nicht, was den Steuerzahler die abenteuerlichen Deals der städtischen Finanzverwaltung kosten werden. Die Kommune hatte im Jahr 2007 zur Absicherung einer auslaufenden Kreditlinie über 195 Millionen Schweizer Franken, was damals 152 Millionen Euro entsprach, bei einer Bank einen sogenannten Swap-Vertrag abgeschlossen. Diese Kurs-Zins-Wette hat Linz allerdings wegen des Franken-Höhenfluges verloren. Der zuständige Finanzstadtrat Johann Mayr (SPÖ) will ähnlich wie sein zurückgetretener Salzburger Kollege von den abenteuerlichen Geschäften in seinem Ressort nichts gewusst haben. Viele Indizien sprechen dafür, dass die verantwortlichen Politiker im Prinzip durchaus informiert waren, aber die Tragweite der selbst für Experten oft undurchschaubaren Deals nicht erkannt hatten.
Vielen war es bis zum globalen Finanzcrash 2008 durchaus verlockend erschien, die Leere in den öffentlichen Kassen durch wundersame Geldvermehrung an den Finanzmärkten zu beseitigen. Weil sich Länder und Kommunen dabei nicht gern auf die Finger schauen ließen, mangelt es auch an Transparenz. Josef Moser, Präsident des Bundesrechnungshofes, vermutet daher noch »milliardenschwere Zeitbomben« in den Bilanzen von Ländern und Kommunen.
Zumindest sollen neue Bomben nicht mehr gelegt werden können, denn unter dem Eindruck des Salzburger Skandals wollen die Regierungsparteien in Wien nun das Zocken mit Steuergeldern verbieten. Ein entsprechender Passus soll in die Verfassung geschrieben werden. Die Details des Verbots und der Durchsetzung wird ein Vertrag zwischen Bund, Ländern und Gemeinden regeln. Demnach sollen Fremdwährungskredite sowie die Anlage öffentlicher Gelder in Fremdwährungen ebenso untersagt sein wie Geschäfte mit Derivaten. Auch die Spekulation mit eigens dafür aufgenommenen Krediten wird verboten.
Laufende Geschäfte sind von dem Verbot nicht betroffen. Eine sofortige Rückabwicklung würde bedeuten, dass Buchverluste realisiert werden müssten. Angesichts der leichten Entspannung in der Schuldenkrise hofft die Politik, dass dadurch ein Ausstieg zu einem späteren Zeitpunkt günstiger sein könnte. Es könnte aber auch anders kommen - so wie das eben ist bei Spekulationsgeschäften.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.