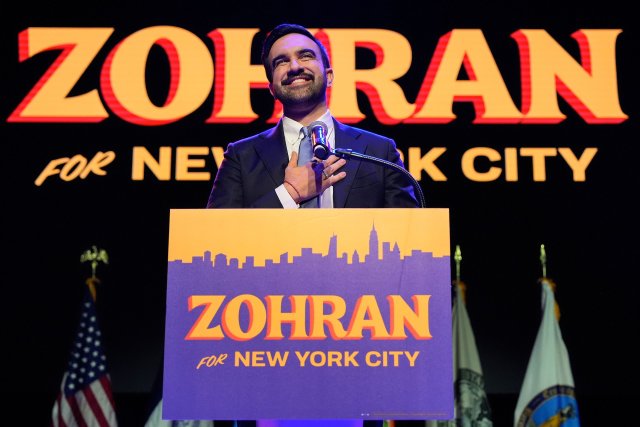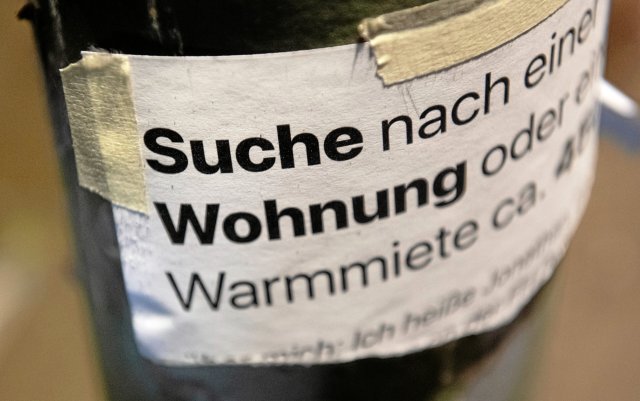Russland will seine Brüder nicht im Stich lassen
Tagung des Sicherheitsrates in Moskau / Rechtsverbindliche Verträge werden eingehalten
Die Entwicklung der Ukraine war dem russischen Nachbarn am Dienstag die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates wert. Dabei beriet Präsident Wladimir Putin auch mit den Spitzen der »starken Ministerien« für Inneres, Äußere Angelegenheiten und Verteidigung sowie den Chefs der Geheimdienste Inland und Ausland. Bereits in der Nacht hatte Putin mit seinen Kollegen in Frankreich, Kasachstan und Belarus die Situation in der Ukraine erörtert. Einzelheiten teilte sein Pressedienst zwar nicht mit, doch ist die Grundrichtung der Moskauer Politik klar.
So erklärte Außenminister Sergej Lawrow, dass Moskau vor neuen Hilfeleistungen für die Ukraine erst einmal Zusammensetzung und Programm der neuen Regierung kennen müsse. Das betreffe vor allem die Maßnahmen der neuen Macht zur Stabilisierung der Wirtschaft. Vorbedingungen dafür seien sofortiger Verzicht auf Gewalt, Wiederherstellung der Gesetzlichkeit und nationale Aussöhnung.
Ähnlich hatte sich am Montag schon Regierungschef Dmitri Medwedjew geäußert. Russland werde trotz des Machtwechsels in Kiew jene Hilfsabkommen erfüllen, die bereits »rechtsverbindlich« seien. Dabei handle es sich »nicht um eine Kooperation mit konkreten Personen« - gemeint war der gestürzte Staatschef Viktor Janukowitsch - sondern um »zwischenstaatliche Beziehungen«.
Die Preisrabatte für russische Gaslieferungen, sagte Medwedjew, hätten jedoch exakte Laufzeiten. Wie sich die Zusammenarbeit nach deren Ablauf entwickle, sei Gegenstand von Verhandlungen mit der künftigen ukrainischen Regierung, einer demokratisch legitimierten. Derzeit gebe es in Kiew keine Gesprächspartner. Einige ausländische Partner Russlands sähen das zwar anders, es sei jedoch eine »Bewusstseinsstörung«, das Ergebnis eines bewaffneten Aufstands als legitim zu bezeichnen.
Adressat der Botschaft war die EU, mit deren Position sich auch eine scharfe Erklärung des russischen Außenministeriums auseinandersetzt. Einige westliche Partner Russlands, heißt es dort, ließen sich nicht »von der Sorge um das Schicksal der Ukraine, sondern von einem einseitigen geopolitischen Kalkül« leiten. Moskau vermisse »klare Stellungnahmen zu extremistischen Verbrechen sowie neonazistischen und antisemitischen Erscheinungen« in der Ukraine. Schweigen fördere derartige Handlungen »gewollt oder ungewollt«.
Rechtsradikale Protestler hatten während der Unruhen in Kiew neonazistische Parolen gegrölt und auf einem von ihnen besetzten Gebäude Hakenkreuze gemalt. Moskaus Kritik richtet sich aber auch gegen die Heroisierung von ukrainischen Kollaborateuren der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und die Abschaltung russischer Fernsehkanäle, die von der neuen Macht in Kiew mit »Volksverhetzung« begründet wird.
Die Ukraine, klagte das russischen Außenamt an, nehme »Kurs auf diktatorische und zuweilen terroristische Methoden, um Andersdenkende in verschiedenen Regionen niederzuhalten«. Gemeint waren die Schwarzmeerhalbinsel Krim, die bis 1954 zu Russland gehörte, bevor sie von Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow der Ukraine zugeschlagen wurde, und die industriellen Ballungsgebiete im Osten. Auch dort verfügen ethnische Russen über eine deutliche Bevölkerungsmehrheit.
Zu deren Schutz forderten zwei oppositionelle Fraktionen - die Mitte-Links-Partei »Gerechtes Russland« und die ultranationalen Liberaldemokraten - ein vereinfachtes Verfahren für die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft. Sergej Mironow, Chef von »Gerechtes Russland«, sprach sich zudem für die Übernahme der ukrainischen Sondereinheit Berkut durch das russische Innenministerium aus. Den »Steinadlern« vor allem lasten die neuen Kiewer Machthaber Blutvergießen an. Den Berkut-Kommandos drohten, weil »Janukowitsch sein Volk verraten habe, Verfolgungen und Repressionen«, sagte Mironow.
Leonid Sluzki, Vorsitzender des Duma-Ausschusses für die Angelegenheiten der UdSSR-Nachfolgegemeinschaft GUS und die Beziehungen zu Landsleuten im Ausland, mahnte indes zu Besonnenheit. Ein russischer Pass in sechs Monaten sei »Wunschdenken unserer Krim-Kollegen«, sagte er der Nachrichtenagentur RIA/Nowosti. Russland werde seine »Brüder in der Ukraine in diesem Zivilisationskampf jedoch nicht im Stich lassen«.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.