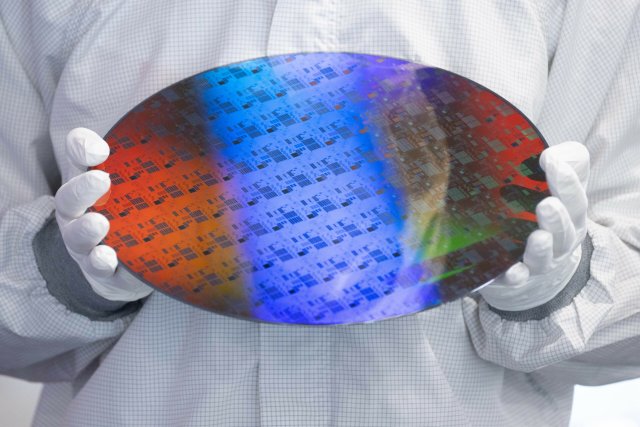Regierungsvertreter entschärfen den Weltklimabericht
Drittes Kapitel zur Minderung der CO2-Emissionen wird am Sonntag in Berlin vorgestellt
Wie die Erderwärmung abgemildert werden kann, ist die entscheidende Frage beim Klimaschutz. Bei der Beantwortung wird um jeden Satz gerungen, Zeile für Zeile: Seit Montag verhandeln in Berlin Hunderte Wissenschaftler mit Vertretern aus über 120 Staaten über den genauen Wortlaut des dritten Kapitels des Weltklimaberichtes. Denn am Sonntag soll die Zusammenfassung der Arbeitsgruppe drei der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dabei geht es vor allem darum, wie klimawirksame Treibhausgasemissionen vermindert werden können.
Insbesondere die Regierungsvertreter bemühen sich bei solchen Tagungen üblicherweise darum, ihnen unangenehme Formulierungen abzuschwächen. Denn so wichtig die Erkenntnisse sind, noch immer richten die Politiker ihr Handeln nach dem Wahlkalender aus. Es geht ihnen darum, ihr Gesicht zu wahren. »Wir wurden gehört, die Interessen unseres Landes sind im Sachstandsbericht des Weltklimarates gewürdigt worden«, erklärt Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegner-Institut das Gebaren der Politik. Der Biologe hatte am zweiten Teilbericht zum Thema Anpassungen am Klimawandel mitgearbeitet.
Im aktuellen Kapitel drängen die Forscher auf einen Umbau des Energiesystems und auf drastische Einschnitte bei den Treibhausgasemissionen. In Deutschland ist der Anteil der erneuerbaren Energien zwar auf beinahe ein Viertel gewachsen - dennoch steigt seit 2009 der Ausstoß an klimaschädlichem CO2 wieder. Denn es wurde auch mehr Kohlestrom produziert, die emissionsärmeren Gaskraftwerke wurden dagegen zurückgefahren. Patrick Graichen, Chef des Think-Tanks Agora Energiewende, bezeichnet dies als »Energiewende-Paradox«. Verantwortlich dafür sind die hohen Gas- und die niedrigen Kohlepreise. Der viel zu niedrige Emissionshandelspreis für Kohlenstoff verstärkt die Tendenz noch. »Wir brauchen einen Kohlekonsens«, fordert Graichen deshalb. Gemeinsam mit den Betroffenen der Kohleabbauregionen und den Stromerzeugern solle die Politik eine Strategie entwickeln, wie man künftig auf Kohleverstromung verzichten kann.
Graichen zufolge steht bei Klimaschutzmaßnahmen noch immer die Stromerzeugung zu sehr im Vordergrund. Die Politiker erließen kaum Gesetze, um Bereiche wie Gebäude, Verkehr und Industrie zu steuern, oder sie billigten der Wirtschaft zu viele Ausnahmen zu. Deshalb gingen die Treibhausgasemissionen nicht zurück. Gerade mal ein Prozent der Gebäude in Deutschland wird jährlich saniert. Mindestens zwei bis drei Prozent wären nötig, um die Ziele der Klimapolitik zu erreichen.
Selbst wenn Deutschland den CO2-Ausstoß bis 2050 um 40 Prozent oder mehr reduzieren könnte, wäre das bei Weitem nicht ausreichend, findet der frühere Chef des UN-Umweltprogramms und Leiter des Potsdamer Nachhaltigkeitsinstituts IASS, Klaus Töpfer. »Wir brauche Wege, die andere Länder mitgehen können«, sagte Töpfer am Freitag in Berlin. Auch für Schwellenländer und aufstrebende Staaten müsse die Energiewende möglich und vor allem bezahlbar sein. Dafür brauche es eine globalisierungsfähig Energietechnik.
Viel Zeit zu handeln, bleibt nicht mehr. »In den nächsten zwei Jahrzehnten entscheiden die Politiker über das Klima, in dem die Menschheit die nächsten 500 Jahre leben wird,« sagt Biologe Pörtner. Deshalb müssten diese Leute endlich einmal aufhören, nur im Vierjahresrhythmus der Wahlkalender zu denken.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.