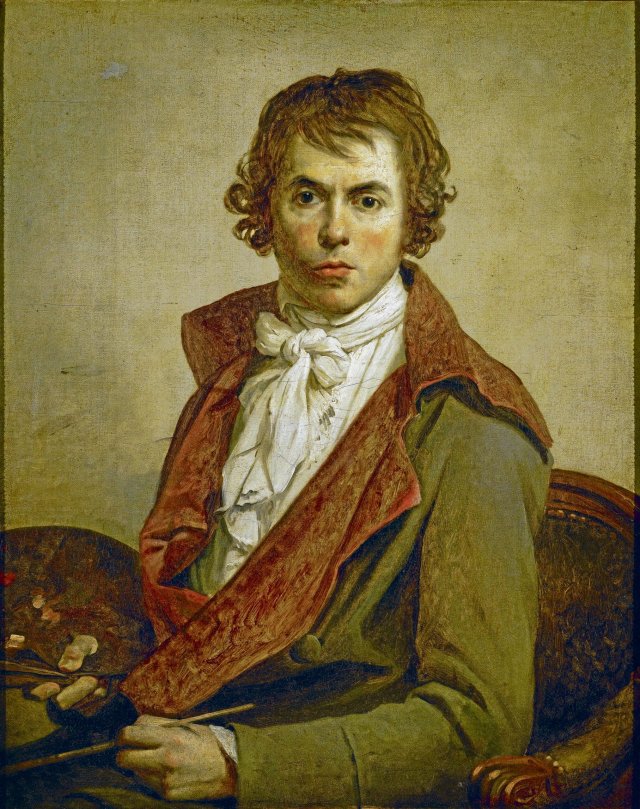Mit der Geige an die Front
Im Film »Die Partitur des Krieges« begegnet Mark Chaet den Menschen beidseits der ukrainischen Konfliktlinie
Vor zwanzig Jahren verließ Mark Chaet den Donbass, um das Geigenstudium, das er am Donezker Konservatorium aufgenommen hatte, an der Berliner Musikhochschule Hanns Eisler zu beenden. Er ist in Deutschland heimisch geworden und längst als Musiker anerkannt. In seine Heimat ist der gebürtige Kramatorsker nicht ein Mal zurückgekehrt. Was er von dort wusste, wusste er aus Medien und aus Telefonaten mit Freunden. Erst als sich der Konflikt in der Ukraine zuspitzte, fragte ihn ein Berliner Bekannter, der Dokumentarfilmer Tom Franke, ob es nicht an der Zeit sei, das Gebiet zu besuchen. Im April 2015 machten sie sich, begleitet von dem Übersetzer Armin Siebert und dem Tontechniker Karsten Gläser, auf den Weg, um Menschen aus Chaets Vergangenheit aufzusuchen. Aus dem Konflikt war inzwischen ein Krieg geworden.
Der auf der Reise entstandene Dokumentarfilm »Die Partitur des Krieges. Leben zwischen den Fronten« ist von einer Unmittelbarkeit, die berührt und entsetzt. Durch die weit geöffneten Augen Mark Chaets, der herausfinden will, was der Krieg mit den Menschen gemacht hat, begegnen wir Verwandten, alten Freunden und Lehrern des Geigers, treffen auf Liedermacher und Orchestermusiker, die dies- und jenseits der Frontlinie einen Alltag aufrecht zu erhalten suchen und die Hoffnung nicht verloren geben wollen.
Die Bilder aus Tom Frankes mit ruhiger Hand geführter Kamera fangen Bilder von großer Herzlichkeit ein - und von bedrückender Resignation. Straßenszenen, die den Krieg Momente lang unsichtbar machen, kontrastieren mit Vorbeifahrten an zerstörten Häusern. Geselliges Beisammensein von Menschen, die beteuern, der Krieg erst habe sie so nahe zusammengebracht, wechselt mit Bombendonner über Donezk oder der Bergung eines schwer verletzten russischen Journalisten. Zwischendrin Mark Chaet, dessen melancholische Kompositionen die Bilder akustisch illustrieren. Wo immer er über karge Plätze und durch geöffnete Türen geht, trägt er den Geigenkoffer in der Hand.
Es mag in der Person des sympathischen Protagonisten begründet liegen, dass von der gelebten Kultur in diesem Film ein Hoffnungsschimmer ausgeht. Wir werden Zeugen einer gut besuchten »Carmen«-Aufführung in Donezk - und erfahren, dass der Keller der Oper als Luftschutzbunker fungiert. Wir lauschen einem Konzert der Philharmoniker der belagerten Stadt - und hören den Sprecher aus dem Off den OSZE-Bericht desselben Tages verlesen: Hunderte Einschläge durch Panzer, schwere Mörser, Artillerie, Maschinengewehre. Trotz Waffenruhe.
Dieser Konflikt sei zu 90 Prozent künstlich erzeugt, meint einer von Chaets Künstlerbekannten. Es sei ein Krieg des Geldes, sagt eine Dorfbewohnerin. Diesen Krieg brauchen nur Leute, die gar nicht hier leben, seufzt Chaets alter Freund Roman.
Premiere am 2.6., 20 Uhr, im Babylon Mitte. Im rbb am 12.7., 23.30 Uhr.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.