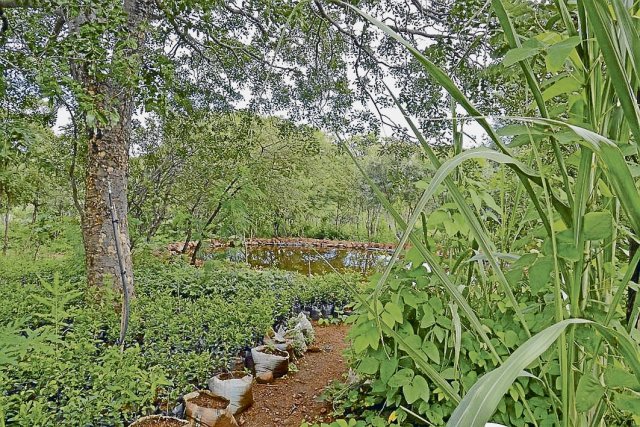App soll verbotene Nazi-Lieder erkennen
LINKEN-Politikerin König-Preuss fordert die Entwicklung einer Software zur automatisierten Titelerkennung rechtsradikaler Songs
Für den polizeilichen Staatsschutz war der Einsatz beim sogenannte »Eichsfeldtag« der rechtradikalen NPD Mitte Mai im thüringischen Leinefelde keine Sternstunde ihrer Arbeit: Auf der Bühne spielte die Schweizer Rechtsrock-Band »Amok« einen verbotenen Titel der britischen Neonazi-Gruppe »Screwdriver«. Doch die Beamten griffen nicht ein – schlicht weil sie das englischsprachige Lied nicht kannten. Wie der MDR berichtete, lagen den Ordnungsbehörden im Vorfeld des Auftritts zwar Musiklisten mit allen Liedern der auftretenden Bands vor, doch der betreffende gespielte Titel »Tomorrow belongs to me« sei nicht darunter gewesen. Besonders ärgerlich: Zwar könnten die Versammlungsbehörden ein Verfahren gegen den Veranstalter einleiten, doch letztlich fehlt nun der Beweis, dass das »Screwdriver«-Lied tatsächlich gespielt wurde. Wie die zuständige Polizei Nordhausen einräumte, hätten die Beamten vor Ort keine Aufnahmen angefertigt. »Ob das Lied tatsächlich abgespielt wurde, kann nicht gesagt werden«, hieß es später in einer Erklärung.
Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, hat die Thüringer LINKEN-Abgeordnete Katharina König-Preuss nun einen Vorschlag: »Um die Staatsschützer zu unterstützen, sollte der Freistaat die Entwicklung einer 'Nazi-Shazam'-App vorantreiben, damit Beamte per Smartphone Titel automatisiert erkennen können. Dies würde die Polizeiarbeit effektiver machen und Polizeibeamte entlasten«, so die Sprecherin für Antifaschismus.
Da Thüringen das »Rechtsrock-Land Nummer eins« sei, bestehe dringender Handlungsbedarf. Eine entsprechende App sei auch deshalb sinnvoll, da sich die rechtsradikale Musikszene europaweit vernetze und englischsprachige Titel daher fester Bestandteil vieler Konzerte seien.
»Fremdsprachenkenntnisse bei der Polizei, insbesondere bei Staatsschutzbeamten, wären natürlich hilfreich, sind aber letztlich zur Erkennung indizierter Lieder nicht das Entscheidende«, so König-Preuss. Niemand dürfe erwarten, dass ein Polizeibeamter sämtliche Neonazi-Lieder kenne »und aus dem Kopf zuordnen« könne. Deshalb bedürfe es alternativer Lösungen, um »künftig zu verhindern, dass Neonazis vor hunderten Anhängern unter den Augen und Ohren des Staates illegale bzw. indizierte Rechtsrock-Musik spielen.« Dabei hätte die App den Vorteil, dass Lieder mittels Audio-Fingerabdrücken innerhalb von Sekunden identifiziert werden könnten. Neben englischsprachigen Texten könnten so auch verbotene Lieder aus den Genres »NS-Hatecore« (NSHC) oder »NS-Blackmetal« leichter erkannt werden, da beide Musik-Stilrichtungen einen nur schwer verständlichen Gesang umfassten.
Völlig neu wäre die Idee solch einer Erkennungsapp speziell für Nazilieder nicht, erklärt König-Preuss. Bereits im Jahr 2013 hätten Innenministerium und Polizei die Idee einer »Nazi-Shazam«-App verfolgt und sogar einen Prototypen entwickelt. »Die durchaus sinnvolle Idee hat es seitdem leider nicht in die konkrete Umsetzung geschafft«, ärgert sich die LINKEN-Politikerin. Angesichts der erkannten Defizite in Leinefelde müsse die Idee aber wieder aufgegriffen werden.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.