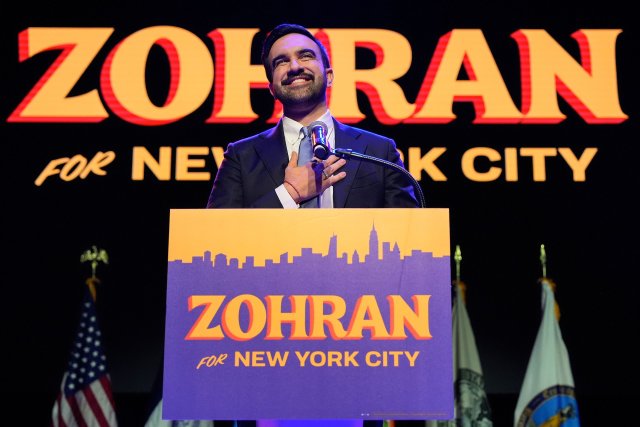Krieg der Worte statt Diplomatie
London sorgt für Eskalation im Streit mit Moskau
Die Wogen schlagen hoch: Nachdem die britische Regierung am Mittwoch 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen hatte, schlug Moskau vier Tage später zurück - 23 britische Diplomaten müssen ihre Koffer packen. Am 4. März waren der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia im südenglischen Salisbury bewusstlos aufgefunden worden; ihre Lage war zuletzt kritisch, aber stabil. Die britische Regierung geht von einem Anschlag mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengas Nowitschok (»Neuling«) aus und meint, nur Russland könne schuldig sein. Moskau sei ja für sein »aggressives Verhalten« bekannt, erklärte Premier Theresa May und forderte Russland auf, binnen 24 Stunden die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag über das »Nowitschok-Programm« zu informieren.
Ultimaten sind eine heikle Sache in der Diplomatie. Russland bat zunächst um eine Probe des Kampfstoffs und forderte die Einhaltung der in der Konvention über das Verbot chemischer Waffen vorgesehenen Verfahren. Bereits am Dienstag kündigte die britische Regierung jedoch »Strafmaßnahmen« an. Kurz darauf beschuldigte Außenamtschef Boris Johnson Wladimir Putin, den Auftrag zur Tat erteilt zu haben.
Längst ist es mehr als ein Konflikt zwischen zwei Staaten. Die NATO unterstützt Londons Forderung, ohne sich in der Schuldfrage festzulegen. Das war Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA zu wenig, die in einer Erklärung Russland des »klaren Bruchs« der Chemiewaffen-Konvention bezichtigten. Allerdings hat das Land im September 2017 seine restlichen Chemiewaffenvorräte gemäß dem Abkommen vernichtet - anders als die USA.
Damit stellt sich die Frage, warum man einen Fall eskalieren lässt, statt ihn auf diplomatischem Wege zu lösen. Geht es Großbritannien trotz Brexit um Schulterschluss mit Verbündeten? Ist das Ganze eine Gelegenheit, das »Feindbild Russland« zu stärken? Dass man nebenbei gegen die Fußball-WM in Russland agieren möchte, liegt auf der Hand.
Bei einer Debatte im UN-Sicherheitsrat hielten sich andere westliche Staaten jedoch zurück. Der Botschafter Kasachstans betonte die politische Sensibilität des Problems und sprach sich für sachliche Konsultationen zwischen beiden Ländern aus. Dem schlossen sich China, Äthiopien, Peru und weitere Staaten an.
Das Wie und Warum des Vorfalls ist mysteriös. Vieles spricht dafür, dass sich mehrere Länder vor Abschluss des Verbotsabkommens mit der Entwicklung neuer Nervenkampfstoffe befassten, darunter Großbritannien. Im Chaos nach dem Zerfall der UdSSR könnten Kampfstoffe und Know-how außer Landes gebracht worden sein. Craig Murray, früherer britischer Botschafter in Usbekistan, verwies darauf, dass die USA dort in den 1990er Jahren einen sowjetischen Chemiewaffenstandort räumten. Es hätte keine Beweise für die Existenz von Nowitschok im heutigen Russland gegeben.
Ferner gibt es Mutmaßungen, Skripal könnte, nachdem er im Zuge eines Agentenaustausches nach England kam, über seine britischen Führungsoffizier in schmutzige Geschäfte der Firma Orbis Intelligence verwickelt gewesen sein.
Eine Verbindung zu mafia-ähnlichen russischen Gruppen schloss Labour-Chef Jeremy Corbyn nicht aus. Vorrang müsse eine geduldige Untersuchung haben, Emotionen und voreilige Urteile seien fehl am Platze, sagte er. Das hätten die Irak-Invasion sowie die Kriege in Libyen und Afghanistan gezeigt.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.