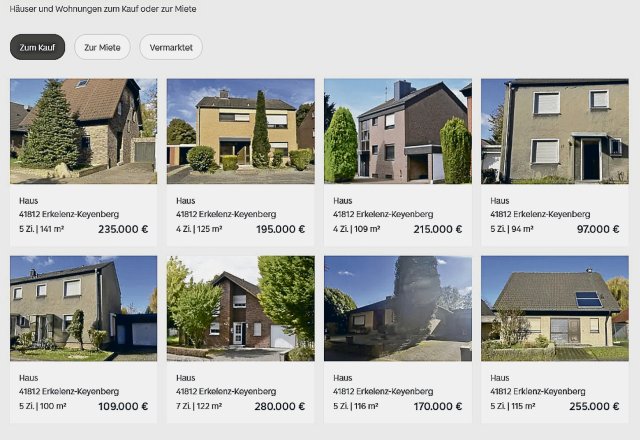- Politik
- Geschlechtergerechte Sprache
Wider Feigenblatt und Formalismus
Ein Plädoyer für die feministische Sprachkritik - und fürs Unruhestiften.
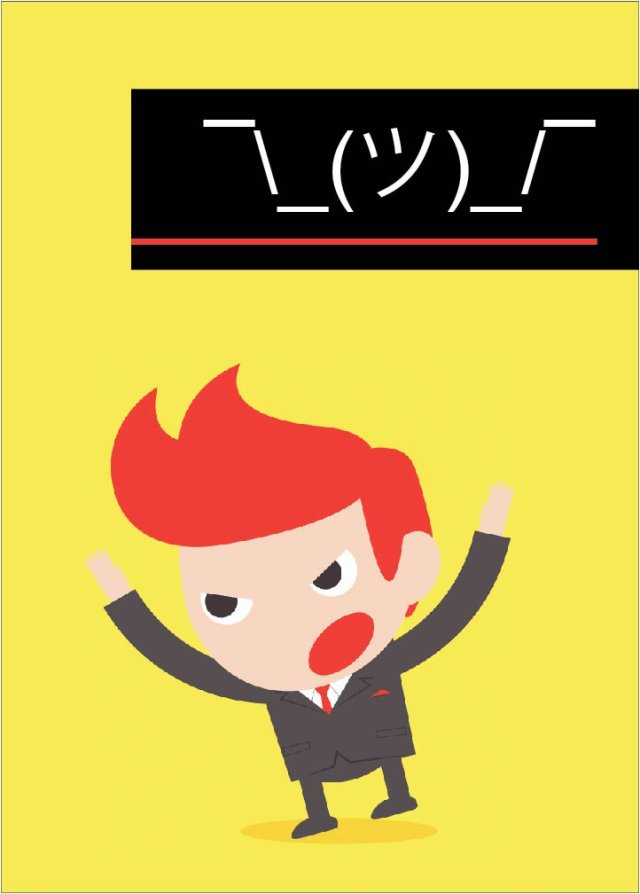
Linke und feministische Äußerungen werden häufig daran gemessen, ob sie in Sachen Gendern auf der Höhe der Zeit sind. Sich dort zu halten, erfordert Aufmerksamkeit: In den letzten Jahren hat der inkludierende, also alle Geschlechter einschließende Plural von Personenbezeichnungen einige Male gewechselt - von RadfahrerInnen zu Radfahrer_innen zu Radfahrer*innen zu Radfahrer:innen, weitere Varianten nicht ausgeschlossen. Für alle gibt es gute Gründe. Das Binnen-I zeigt an, dass neben Männern auch Frauen Fahrrad fahren; der Unterstrich (Gendergap) verweist auf weitere Möglichkeiten von Geschlechtsidentität auf dem Sattel, ebenso das Sternchen; der Doppelpunkt ist überdies barrierearm, weil er von Vorleseanwendungen für Sehbehinderte problemlos realisiert werden kann. Die Aussprache aller Formen ist gleich: eine sehr kurze Pause zwischen dem Wort und der Endung -innen, wie in Heb-amme.
Was aber wenig diskutiert wird, wenn es ums richtige Gendern geht, ist das Geschlechterverhältnis. Die feministische Sprachkritik begann in den 1970er-Jahren mit der Beobachtung, dass das patriarchale Geschlechterverhältnis sich auch in der Sprache niederschlägt. Die Linguistinnen Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz wiesen das an der Ableitungslogik von Personenbezeichnungen nach: Der Radfahrer bezeichnet den Mann, Frauen müssen sich durch das Anhängsel -in kennzeichnen. Sie haben ihre eigene Pluralform: -innen, doch der männliche Plural gilt auch für geschlechtergemischte Gruppen. Dieses generische Maskulinum macht die Anwesenheit von Frauen irrelevant: Ableitungslogisch wird eine Gruppe von eintausend Radfahrerinnen zu Radfahrern, wenn ein einziger Mann hinzu tritt, wohingegen eintausend Radfahrer durch das Dazukommen einer Frau sprachlich unverändert bleiben.
Frauen sollen sich von Verkehrsschildern wie »Radfahrer links halten« mitgemeint fühlen, wohingegen ein Mann verwundert bis verärgert reagieren kann, wenn man ihn als Radfahrerin anspricht. Er allein hat ein Recht auf sprachliche Repräsentanz - und versteht oft nicht, warum Feministinnen ein Problem mit dem doch so geschlechtsneutralen Sprachgebrauch haben, statt sich einfach irgendwie mitgemeint zu fühlen. Wie groß der Schmerz des Nur-irgendwie-mitgemeint-Seins ist, konnte das Feuilleton ermessen, als die Universität Leipzig 2013 ihre neue Grundordnung im generischen Femininum verfasste, also ausschließlich Studentinnen und Professorinnen erwähnte.
Der sprachpolitische Übergang vom Binnen-I, das Pusch und ihre Mitkämpferinnen verfochten, zu Gendergap und Genderstern wird häufig als schlichte Erweiterung verstanden: Nicht nur (Cis-)Frauen sollen explizit gemeint sein, sondern auch Transfrauen, Transmänner sowie nicht-binäre, intersexuelle und genderfluide Personen. Hier liegt ein schwerwiegendes Missverständnis vor. Nicht einfach der Kreis der zu repräsentierenden Gruppen hat sich verändert, sondern das feministische Verständnis von Sprache. Im Geist der Zweiten Frauenbewegung war feministische Sprachkritik Teil einer breit aufgestellten sozialen Bewegung gegen patriarchale Verhältnisse: gegen Gewalt an Frauen, für bessere Bildungsmöglichkeiten, für Gleichheit in der Ehe und auf dem Arbeitsmarkt.
In den 1990ern hat der Linguistic Turn, also die umfassende Hinwendung zur Sprache, nicht nur den frauenzentrierten Feminismus abgelöst, sondern auch die Einordnung von Sprache als einem Teil, einem Aspekt gesellschaftlicher Verhältnisse. Seither fallen in vielen Strömungen feministischer und linker Politik Sprache und Gesellschaft, Sprache und Diskriminierungsverhältnisse, ja Sprache und Sein tendenziell in eins.
Feministische Politik wird heute von mancher Seite als Sprachpolitik verstanden, die nicht unbedingt mit der Analyse anderer Ursachen von Diskriminierung und gesellschaftlicher Strukturen verbunden werden muss. Kämpfe werden der Lesart zufolge um die richtigen Bezeichnungen geführt - als könnten Wörter an sich frauen-, lesben- oder transfeindliche Missstände heraufbeschwören oder abschaffen. Die Falsch- oder Nichtnennung einer Gruppe oder Person käme folglich ihrer Existenzvernichtung gleich. Im Zuge der Anerkennungskämpfe diverser geschlechtlicher Gruppen sollen Personenbezeichnungen möglichst inklusiv sein. Es ist eine Ironie der feministischen Sprachkritik, dass wir nach all den Bemühungen, Frauen sprachlich zu repräsentieren, heute bei einer inklusiven Geschlechterneutralität angekommen sind. Gegenderte Pluralbezeichnungen sowie Verlaufsformen (Radfahrende) zeigen an, dass alle Geschlechter gemeint sind. Im Kampf um eine geschlechtergerechte Welt ist das ein wichtiges und angebrachtes Mittel.
Gleichzeitig beschränken solche Bezeichnungen die Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis häufig aufs Formale. Die Rede von Täter_innen sexueller Gewalt verbirgt, dass sexuelle Gewalt ziemlich viel mit der zerstörerischen Seite von Männlichkeit im kapitalistischen Patriarchat zu tun hat und daher meistens, wenn auch nicht ausschließlich, von Cis-Männern ausgeübt wird. Es ist ein seltsamer Glaube, dass man solche Sachverhältnisse - statt sie in Sätzen zu beschreiben - mit inklusivem Sprechen und Schreiben sozusagen symbolisieren könnte. Auch in feministischen Publikationen heißt es oft in Fußnote 1, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt: »Wir schreiben Radfahrer*innen, um zu verdeutlichen, dass Menschen aller Geschlechter gemeint sind.« Was für eine sonderbare Letztbegründung, die vorgibt, allein mit der Verwendung eines bestimmten Symbols eine Kritik am Geschlechterverhältnis zu leisten!
Der übergroße Fokus auf eine mit Symbolen gespickte Textoberfläche tendiert dazu, Codes hervorzubringen, die nirgendwo eingelöst werden. Dafür mangelt es oft an gut verständlichen Beschreibungen und streitbaren Aushandlungen über mögliche gemeinsame Kämpfe der verschiedenen IdentitätsinhaberInnen. Wenn Texte nachträglich gegendert oder Neuauflagen und Übersetzungen älterer Publikationen mit Sternen verziert werden, zerreißt die Verbindung von sprachlicher Form und Inhalt vollends.
Schlimmstenfalls erfüllt das Gendern, das nicht mehr in den Kontext einer patriarchatskritischen Analyse gestellt wird, die Funktion eines Feigenblatts. So ist die Anrede »liebe Bürgerinnen und Bürger« oder »Genoss:innen« fester Bestandteil langer Redebeiträge von CDU-Politikern und Plenumsmackern, die glauben, damit hinsichtlich Frauenrechten und Geschlechtergerechtigkeit Hinlängliches geleistet zu haben. Bei aller Kritik am Linguistic Turn: Die Trennung von Form und Inhalt hat er lediglich radikalisiert. Sie ist der Hinkefuß jeder Sprachkritik, die konkrete formale Änderungen innerhalb der bestehenden Verhältnisse fordert. Persönlich habe ich das Gendern als Jugendliche in Tupperware-Broschüren kennengelernt, die im Kolleginnenkreis meiner Mutter kursierten und die Hausfrauenherzen der »lieben LeserInnen« höher schlagen lassen sollten.
Formalisierte Sprachkritik stellt auch Journalist*innen und andere feministische Autor*innen vor ein Paradox: Dem pragmatischen Bedürfnis nach guter Lesbarkeit und Barrierearmut zufolge soll so einheitlich und übersichtlich gegendert werden, dass man möglichst nicht darüber stolpert. Die Leserinnen sollen sich, ungestört vom Geschlechterverhältnis, auf den Inhalt konzentrieren können, während das Geschlechterverhältnis irgendwie doch berücksichtigt ist. Damit wird das Problem eingehegt und sein kritisches Potenzial entschärft.
Ich habe keine Lösung für dieses Paradox. Den Widerspruch zwischen politischer Repräsentanz und Inklusion aller Geschlechter einerseits und Gesellschaftsanalyse andererseits wird man übers Gendern nicht los - erst recht nicht, wenn man versucht, ihn mit der einen richtigen Pluralform stillzustellen und die Diskussion um Sprachpolitik damit ad acta zu legen. Gleichzeitig wäre es eine Kapitulation vor der patriarchalen Beschaffenheit unserer Sprache, zu den Radfahrern zurückzukehren. Die Verfechter des generischen Maskulinums - zu denen nicht einmal mehr die Duden-Redaktion gehört - zeigen eindrücklich, dass die Ablehnung von Sprachfeminismus häufig mit anderen antifeministischen Positionen einhergeht.
Stattdessen plädiere ich dafür, die Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache als Unruhestifterin, als formalen wie inhaltlichen Anspruch einzuordnen, wie sich feministisch sprechen und schreiben lasse in patriarchalen Verhältnissen, die es dringend umzugestalten gilt. Im Interesse einer welthaltigen feministischen Debatte sollten wir Wörter und Sätze als Werkzeuge zum Diskutieren, Erklären und Widersprechen nutzen; zur gemeinsamen Verständigung darüber, wie sich den patriarchalen Verhältnissen am besten in die Suppe spucken lässt.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.