- Wissen
- 50 Jahre »Radikalenerlass«
Die Jagd ist nicht vorbei
Im Januar 1972 - zeitgleich zum »Marsch durch die Institutionen« der Neuen Linken - verabschiedete die Koalition von SPD und FDP den »Radikalenerlass«. Die Berufsverbote, praktisch ausschließlich gegen Linke, hatten verheerende Konsequenzen, die bis heute andauern
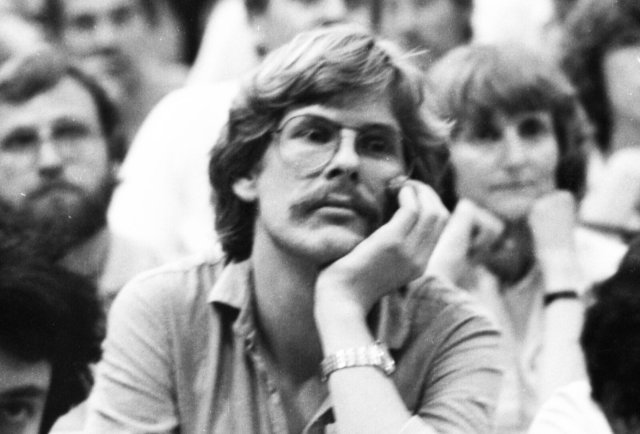
Vor fast genau 50 Jahren, am 28. Januar 1972, verabschiedeten die Ministerpräsidenten der Länder unter Vorsitz von Willy Brandt den »Extremistenbeschluss«, besser bekannt als Radikalenerlass. In der Folge wurden sämtliche Bewerber*innen für den Öffentlichen Dienst einer Überprüfung durch den Inlandsgeheimdienst unterzogen, aber auch altgediente Beamt*innen wurden geheimdienstlich durchleuchtet und zu Verhören geladen. De facto waren es die Verfassungsschutzbehörden, die nun entscheiden konnten, wer als »Radikaler«, als »Extremist« oder als »Verfassungsfeind« zu gelten hatte. Personen, die laut Beamtengesetz »nicht die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten«, wurden aus dem Öffentlichen Dienst entfernt oder gar nicht erst eingestellt. Daraus erfolgte ein zuvor undenkbarer Machtzuwachs für den Inlandsgeheimdienst; seine personellen und logistischen Ressourcen wurden ebenso stetig erweitert wie seine Kompetenzen und Rechte - ein Prozess, der bis heute anhält. Dadurch, dass der Verfassungsschutz nun quasi Strafbefugnisse erhalten hatte, wurde auch das sogenannte Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei weitgehend ausgehöhlt.
Olga Hohmann versteht nicht, was Arbeit ist und versucht, es täglich herauszufinden. In ihrem ortlosen Office sitzend, erkundet sie ihre Biografie und amüsiert sich über die eigenen Neurosen. dasnd.de/hohmann
Die Überprüfungen führten bundesweit zu etwa 11 000 Berufsverbotsverfahren, 2200 Disziplinarverfahren, 1256 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Das sind zumindest die Zahlen, die der »Bundesausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote« in den Jahren 1972 bis 1984 zusammengetragen hat. Die wirkliche Zahl der Berufsverbotsverfahren gegen Linke dürfte weitaus größer sein - Bund und Länder haben die Zahlen bezeichnenderweise nie erfasst. An den Bundesausschuss, dem im innerlinken Streit DKP-Nähe nachgesagt wurde, der in Wirklichkeit aber Menschen bis weit ins liberale Lager hinein vereinte, wandten sich viele Mitglieder der K-Gruppen oder der Sponti-Szene gar nicht erst. Strittig war vor allem, dass viele radikalere Linke es ablehnten, gegenüber dem Staat, der sie als Verfassungsfeinde verfolgte, Bekenntnisse zum Grundgesetz abzulegen.
Im Visier ist nur die Linke
Wie viele Menschen tatsächlich von den Berufsverboten der 1970er und 1980er Jahre betroffen waren, lässt sich also nur schätzen. Die Vielen, die es angesichts drohender Jahre von Verhören und Prozessen vorzogen, sich beruflich anders zu orientieren, sind ohnehin nachträglich nicht mehr zu zählen. Von den Berufsverbote betroffen waren nicht nur Mitglieder der DKP und diverser K-Gruppen, sondern auch andere Linke - bis hin zu der SPD nahen Studierendenverbänden, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) und Gewerkschafter*innen. Verschont von der Verfolgung blieben hingegen Rechte im Staatsdienst - Tausenden von Verfahren gegen Linke stehen ganze fünf gegen Rechte gegenüber. Diese waren überdies teils schlicht Strafverfahren, also Disziplinarverfahren, die mit dem Radikalenerlass wenig zu tun hatten.
Die Dimensionen, in denen die Berufsverbote gegen Linke das gesellschaftliche Klima der BRD geprägt haben, sind kaum abzuschätzen. Wer einmal zum Verfassungsfeind erklärt war, wurde dieses Stigma so schnell nicht mehr los. Außerdem unternahm der Staat selbst nach teils langjährigen erfolgreichen Prozessen oft noch einmal einen neuen Anlauf der politischen Verfolgung. Zerstörte Biografien und nicht selten tiefsitzende Traumata waren die Folge bei vielen Betroffenen, die nicht mehr arbeiten durften. Aber auch, wer »nur« vor einer Kommission abgeschworen, sich also gegen seine eigentliche Überzeugung von seinen politischen Grundsätzen distanziert hatte, war davon für sein weiteres Leben nicht unerheblich geprägt.
Die Verheerungen, die diese regelrechte Hexenjagd in der politischen Kultur der BRD angerichtet hat, sind bis heute spürbar. Auch jetzige Lehramtsstudierende haben, selbst wenn sie nichts über die Berufsverbote und ihre Geschichte wissen, meist sehr wohl verinnerlicht, dass von deutschen Beamt*innen Konformität und Stromlinienförmigkeit erwartet wird. Es wird unter anderem auch diesem Umstand geschuldet sein, dass der Staat seit 1984 nur noch gelegentlich versucht hat, an die Praxis der Berufsverbote anzuknüpfen - in gewisser Weise hatten diese schlicht ihren Zweck erfüllt. Sicherlich spielte allerdings auch eine Rolle, dass die BRD 1995 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg für ihre Berufsverbotspraxis verurteilt wurde, und zwar für den Fall der Lehrerin Dorothea Vogt, die nach ihrem Berufsverbot ins französische Exil gegangen war. Bereits 1987 hatte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) erklärt, die Berufsverbote in Deutschland verstießen gegen das Übereinkommen über die »Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf«, das die BRD 1961 ratifiziert hatte und das deshalb eigentlich als innerstaatliches Recht zu gelten habe.
Kontinuitäten zum Nationalsozialismus
Im Ausland hatten jedenfalls bereits 1972 die Alarmglocken geschrillt. In anderen europäischen Staaten wie Italien und Frankreich wurde bereits die Frage, ob ein Kommunist Lehrer, Zugführer oder Briefträger werden kann, als absurd wahrgenommen - warum sollte er das nicht sein? Außerdem zeigten sich in dem Gesetz deutsche Kontinuitäten: Die juristische Grundlage des »Radikalenerlasses«, die sogenannte Gewährbieteklausel der deutschen Beamtengesetze, basierte auf dem »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933. Dieses war die erste gesetzliche Grundlage für die politische und »rassische« Gleichschaltung des Öffentlichen Dienstes im Nationalsozialismus. Darin hieß es, dass im Staatsdienst keine Menschen geduldet werden können, »die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten«.
Die BRD ersetzte dann »nationaler Staat« schlicht durch »freiheitlich-demokratische Grundordnung«, ein Unterschied ums Ganze, wie die Befürworter*innen der Gewährbieteklausel argumentieren. Wesentlich an der Formulierung ist allerdings nicht ihre Zielbestimmung, sondern die Figur des »jederzeitigen Gewährbietens«, dessen Beurteilung dem Dienstherrn, hier also dem Staat, überlassen wird. Dieser erhält damit die Aufgabe, eine »Gesinnungsprognose« zu erstellen, außerdem wird die (eigentlich im deutschen Rechtssystem festgeschriebene) Beweislast umgekehrt: Nicht der Staat muss etwaige verfassungsfeindliche Umtriebe wirklich nachweisen, sondern der Bewerber oder die Bewerberin hat jeglichen Zweifel für ein solches (auch zukünftiges) Verhalten auszuräumen - ein nahezu unmögliches Unterfangen.
Entsprechend reichte es eben häufig auch gar nicht aus, wenn sich die Verdächtigten nicht offen gegen die Verfassung wendeten und alle Gesetze befolgten. Die »politische Treuepflicht« erfordere nämlich »mehr als nur formal korrekte, im Übrigen uninteressierte, kühle innerlich distanzierte Haltung gegenüber dem Staat«, wie der Verfassungsrichter Willi Geiger 1975 in einem wegweisenden Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Radikalenerlass dekretierte. (Geiger war bereits im Nationalsozialismus Richter gewesen, davor SA-Rottenführer.)
Für die von Berufsverboten Betroffenen der 1970er Jahre geht es allerdings nicht allein um die Heilung seelischer Wunden oder um die massiven Einkommenseinbußen, wegen denen etliche von ihnen mittlerweile in Altersarmut leben. Ihre Verfolgung und Diffamierung dauert vielmehr zum Teil bis heute an. Silvia Gingold, Tochter jüdischer Résistance-Mitglieder und 1975 wegen der ihr vorgeworfenen DKP-Nähe mit Berufsverbot belegt, klagte 2013 gegen ihre fortwährende Bespitzelung durch den Verfassungsschutz und verlangte Einsicht in ihre Akten. Obwohl diese ihr weitestgehend verwehrt wurde, wird aus den Textbruchstücken der geschwärzten Seiten, die sie im Lauf des Verfahrens zu sehen bekam, deutlich, dass sie bis heute Beobachtungsobjekt des Geheimdienstes ist. Registriert wurde etwa ihr Engagement in der VVN-BdA, in der Friedensbewegung und Lesungen aus der Autobiografie ihres Vaters.
Werner Siebler - Berufsverbot 1984 als Postbeamter und heute DGB-Vorsitzender in Freiburg - erhielt erst vor wenigen Wochen »im Zuge des Ermessens« Antwort auf sein Auskunftsersuchen beim Verfassungsschutz: Auch bei ihm sind die Herren (und Damen) vom Dienst bis heute tätig. Erfasst wurden in den vergangenen Jahren sein Engagement bei Ferienfreizeiten der »Roten Peperoni«, bei Ostermärschen oder gegen Naziaufmärsche.
Beide Fälle offenbaren ein Muster: Als »verfassungsschutzrelevante Erkenntnis« wird unter anderem gewertet, dass Siebler und Gingold sich für die Aufarbeitung der Berufsverbote und die Rehabilitierung der Betroffenen einsetzen. Auch die Tatsache, dass sie 2004 in meinem eigenen Fall gegen die Wiederbelebung der Berufsverbote protestierten und eine Solidaritätserklärung unterzeichneten, wird ihnen zum Vorwurf gemacht. Das gegen mich verhängte Berufsverbot 2007 wurde vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim als grundrechtswidrig aufgehoben. (Dieser Logik folgend, müsste der Verfassungsschutz pikanterweise eigentlich auch den VGH auf seine Beobachtungsliste setzen.) Den Verfassungsschutz kümmert diese Gerichtsentscheidung allerdings wenig. Auch in meinem Fall besteht die Behörde trotz der im Nachgang des Urteils erfolgten Verbeamtung auf meiner fortdauernden Beobachtung als Verfassungsfeind und verweigert mir die Einsicht in die gesammelten Daten.
Mit dem Radikalenerlass war nicht nur massenhaft staatlicherseits Unrecht verbunden, sondern es wurde auch der Demokratie erheblicher Schaden zugefügt. Trotzdem stoßen die Bemühungen der Betroffenen, noch zu Lebzeiten ihre Rehabilitierung und Entschädigung zu erreichen, bislang auch bei der neuen rot-grün-gelben Regierung auf taube Ohren. Dabei war der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, als damaliger Maoist selbst vom Berufsverbot betroffen und wurde nur auf die Intervention eines liberal gesinnten Hochschulrektors hin eingestellt. Im Interview mit der ARD erklärt der Politiker von Bündnis 90/Die Grünen heute, dass es eine allgemeine Entschuldigung bei allen Betroffenen nicht geben könne. Ähnlich lauten die Statements aus anderen Bundesländern: Es sei in einzelnen Fällen sicher Unrecht geschehen, die Opfer des Radikalenerlasses insgesamt zu rehabilitieren, ginge aber nicht an. Auf der Tagesordnung stehe nun erst einmal eine wissenschaftliche Aufarbeitung dessen, was damals überhaupt geschehen sei, erst danach könne man unter Umständen Einzelfälle noch einmal prüfen. Dazu erklärte der Sprecher der bundesweiten Initiative, Klaus Lipps, sarkastisch: »Auf unsere Grabsteine brauchen sie die Entschuldigung nicht zu schreiben.«
Extremistenbeschluss bleibt
Dass die staatlichen Behörden vor einer Verurteilung des Radikalenerlasses zurückscheuen, liegt sicher auch daran, dass die Ampel-Koalition auf dieses bewährte Repressionsinstrument nicht verzichten mag. Pünktlich zwei Wochen vor dem 50. Jahrestag des Radikalenerlasses twitterte die neue Ministerin für Inneres und Heimat, Nancy Faeser, Bezug nehmend auf den Koalitionsvertrag: »Wir werden Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen. Extremisten haben in Behörden nichts verloren.« Die Hoffnung, diesmal seien bestimmt die Rechten gemeint, auch wenn Faeser in altbekannter »Hufeisenmanier« ganz allgemein von »Extremisten« schreibt, dürfte sich als trügerisch erweisen. Wenn schon die aktuell geltenden, denkbar weitreichenden Bestimmungen faktisch nie gegen Rechte angewendet wurden, stattdessen massenhaft gegen links, erscheint die Hoffnung, dies würde sich mit noch weitreichenderen Befugnissen ändern, bestenfalls naiv. In sämtlichen aktuell diskutierten Fällen von Nazis in Uniform hätten die Bestimmungen des Grundgesetzes und des Strafrechts völlig ausgereicht, um gegen sie vorzugehen. Tatsächlich geschehen ist das aber nur sehr selten.
Wer Extremist*in ist, entscheidet immer noch in erster Linie der Verfassungsschutz, in zweiter Linie entscheiden die Gerichte. So ist mit dem Inlandsgeheimdienst eine Institution, deren politische Ausrichtung nicht erst seit der Verstrickung in die NSU-Mordserie und den Skandalen um seinen einstigen Chef Hans-Georg Maaßen bekannt ist, zuständig für die Definition und das Aufspüren von »Verfassungsfeinden«. Zumal den linken Betroffenen von Berufsverboten ist es also kaum zu verdenken, wenn sie auf einen geplanten neuen »Radikalenerlass« - diesmal angeblich im Kampf gegen Rechts - mit Entsetzen reagieren. In einer Presseerklärung schreiben einige von ihnen: »Wir sind fassungslos und schockiert, dass die neue Bundesregierung nicht nur die Augen vor diesem jahrzehntelangen staatlichen Unrecht verschließt, sondern sich anschickt, dieselben Fehler zu wiederholen.«
Gegen Michael Csaszkóczy wurde im Jahr 2004 ein Berufsverbot als Lehrer wegen seines Engagements in antifaschistischen Gruppen und bei Rote Hilfe e. V. verhängt. Es war seit 1984 der erste Versuch, diese Praxis wiederzubeleben. 2007 verurteilte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Maßnahme als Grundrechtsverletzung. Seitdem arbeitet Csaszkóczy wieder als Lehrer.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.







