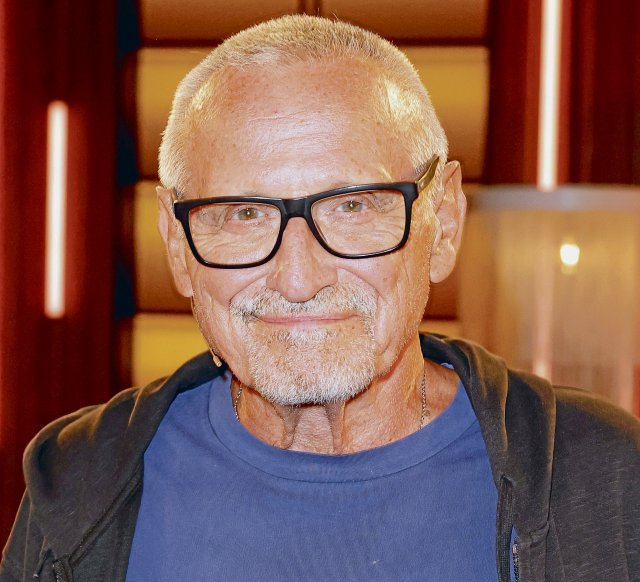- Kultur
- Aktivismus auf Twitter
Sisyphusarbeit Online-Aktivismus
Der Kampf gegen menschenverachtende Falschheiten auf Social Media wird durch die Strukturen der Plattformen stark erschwert
»NGO ist das neue N-Wort.« Tweets dieses Kalibers gibt es zu jedem Thema, zu Corona-Impfung, Selbstbestimmungsgesetz und Nato ebenso wie zu allen Marvel-Blockbustern und dem neuesten Promidrama. Man sieht sie ungern und viel zu oft, macht sich aber meist nach einem ausgiebigen Augenverdrehen oder enttäuschten Kopfschütteln nicht weiter Gedanken darüber.
Aber was ist mit den Menschen, über die in unverschämten Beiträgen Falschheiten verbreitet werden? Sie und ihre Unterstützer*innen müssen oftmals gegen diese Fake News ankämpfen, insbesondere wenn der Tweet viel Aufmerksamkeit bekommt. Sofort entsteht ein Ungleichgewicht, denn bodenlose Behauptungen in die Welt zu setzen, erfordert wesentlich weniger Arbeit, als mit Argumenten oder sogar wissenschaftlichen Quellen zu kontern.
Dazu kommt, dass die Aktivist*innen, die sich gegen diese Falschaussagen stemmen, häufig einer von Diskriminierung betroffenen Gruppe angehören. Das ist in gewisser Weise logisch, denn es liegt nahe, sich gegen die eigene Marginalisierung einzusetzen. Dieser Umstand sorgt allerdings dafür, dass Personen, die ohnehin schon Zielscheibe einer menschenverachtenden Ideologie sind, sich weiter gefährden.
Das musste zum Beispiel Wissenschaftlerin Dana Mahr erleben, die mit wissenschaftlichen Quellen gegen kursierende Behauptungen der angeblich nicht belegten Verfolgung von trans Menschen unter dem NS-Regime kämpfte. Die folgende Hass-Kampagne, die sie erlebte, war so schlimm, dass sie ihren Wohnort wechseln musste, weil ihre Adresse veröffentlicht wurde. Sie ist selbst trans.
Die Algorithmen von Social-Media-Plattformen erschweren die Arbeit gegen extreme Falschheiten zusätzlich. Insbesondere Twitters Algorithmus ist bekannt für seine Fähigkeit, Nutzer*innen wütend zu machen – und vor ihren Bildschirmen zu halten. Denn wenn ein Tweet so menschenverachtend ist, dass man sich gegen die Aussage wehren muss, heißt das für Twitter mehr Zeit, die Menschen mit ihrer App verbringen. Somit verlängern provokante Tweets mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nutzungsdauer der Plattform. Da diese ihren Profit größtenteils über Werbeeinnahmen generiert, ist dieser Mechanismus absolut in ihrem Interesse – oder besser gesagt: im Interesse ihrer Aktionär*innen.
Dagegen kommt Aufklärungsarbeit, die schrittweise argumentiert und wissenschaftliche Arbeiten zitiert, nicht an. Ihr Potenzial, unzählige Male geteilt zu werden, ist wesentlich geringer. Tweets der informativen Sorte gehen daher meist unter, während Provokantes, darunter auch gefährliche Falschheiten, den Weg zu vielen Nutzer*innen findet.
Am Ende leiden echte Menschen wie Dana Mahr unter diesen Strukturen, die auf allen Social-Media-Plattformen existieren. Die Schuld liegt bei den Plattformen, die nach wie vor marginalisierten Menschen keinen wirklichen Schutz bieten und die gefährlichen Dynamiken ihrer Algorithmen nicht unterbinden, weil die einzige Richtschnur für ihren Erfolg die Gewinnmaximierung ist.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.