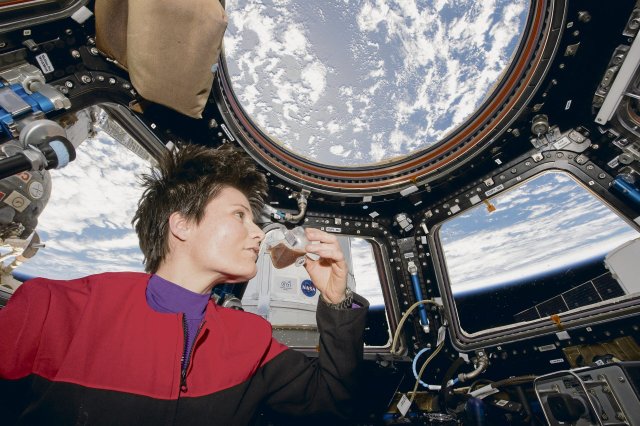- Wissen
- Dr. Schmidt erklärt die Welt
Wie macht man den Bundestag kleiner?
Das deutsche Parlament sucht Hilfe fürs Abnehmen
Von Wahl zu Wahl wird der Bundestag größer. Er nähert sich dem 1000. Abgeordneten. Die Überhangmandate werden immer mehr. Weil die sogenannten Volksparteien aussterben?
Richtig ist, dass die großen Volksparteien immer weniger Stimmen fangen. Was natürlich den Aufstieg kleinerer Parteien mit begünstigt hat. Aber das spielt bei den Erststimmen-Wahlen bei uns noch keine große Rolle. Das ist ein reines K.-o.-System: Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. Das System von Erst- und Zweitstimme bevorteilt derzeit die großen Parteien. Die Überhangmandate bekommt man ja nur als Ausgleich, wenn man in der Verhältniswahl mehr Stimmen bekommt als in der Personenwahl mit der Erststimme. Das fällt immer häufiger auseinander, vor allem in den südlichen Bundesländern. Deswegen werden sich die Politiker wohl etwas ausdenken müssen.
Aber was?
Von der Ampelkoalition gibt es den Vorschlag, die Zahl der Abgeordneten an sich zu deckeln. Das Zweitstimmen-Ergebnis, die Verhältniswahl, soll das Entscheidende sein, aber es soll für die Direktwahl eine dritte Stimme geben, mit der man entscheidet, welchen Kandidaten man dann akzeptieren würde, wenn man seinen Wunschkandidaten nicht bekommt. Das könnte man auch als eine Art Zweit-Erststimme bezeichnen. Da wäre es wohl sinnvoller, wie bei der Betriebsratswahl vorzugehen, dass man also einfach mehrere Namen ankreuzen kann.
Man könnte auch die Wahlkreise vergrößern.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das würde natürlich, wie man so schön sagt, die Repräsentanz der Abgeordneten verschlechtern. Je weiter weg der Abgeordnete von dir ist, desto weniger hat das alles mit dir zu tun und desto mehr sind das »die da oben«, die sowieso machen, was sie wollen.
Findest du das Mehrheitswahlrecht oder das Verhältniswahlrecht besser?
Auf jeden Fall eins von beiden und nicht beide gleichzeitig. Entweder das französische System mit Direkt- und Stichwahl oder eben ein reines Verhältniswahlrecht, was die realen Wählerstimmen im Parlament widerspiegelt. Das hat natürlich den Nachteil, dass letztlich Parteilisten zur Wahl stehen. Und das ist nicht immer das, was der Anhänger der jeweiligen Partei vor Ort unbedingt selber gut finden würde. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel in der Linkspartei erhebliche Dissense vorstellen.
In den USA schrauben sich die Regierenden einfach ihre Wahlkreise so zusammen, wie es ihnen am besten passt.
Das ist nicht bloß in den USA so. Das hat schon De Gaulle im Raum Paris gemacht, als es damals noch den »Roten Gürtel« der KPF gab, der inzwischen ja eher bräunlich ist. Der hatte die Wahlkreise so geschnitten, dass dort die Linken nicht zu groß werden. Und das ist ihm ja dann auch gelungen. Das Mehrheitswahlrecht hat aber noch einen anderen Nachteil: In den USA kann man das sehr schön sehen. Da kümmern sich Abgeordneten vor allem um Vorteile für ihren Wahlkreis, weil das wichtig für die Wiederwahl ist. Was für gesamten USA gut ist, oder auch nur für ihren einzelnen Bundesstaat, zählt da oft nicht. Das geht in Richtung imperatives Mandat, was ja vom Grundgesetz ausgeschlossen wird. Danach sollen nicht die Wähler (und Spender) bestimmen, was der Gewählte entscheidet, sondern dessen Gewissen.
Gut, das ist aber eher Theorie, oder?
Klar. Letztlich machen die auch nur das, was Parteibeschlusslage ist, damit sie wieder aufgestellt werden. Denn die Fälle, wo jemand sich gegen den Willen seiner Partei als Direktkandidat durchgesetzt hat, die sind ja doch sehr dünn gesät. Ströbele oder Palmer bei den Grünen fallen mir da ein, als absolute Ausnahmen. Insofern ist die Frage bei alldem, welches der Verfahren am besten den Eindruck der Wähler beseitigt, dass das Ganze sowieso sinnlos ist. Es gibt ja den berühmten Spruch, wenn Wahlen was verändern können, wären sie längst verboten.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.