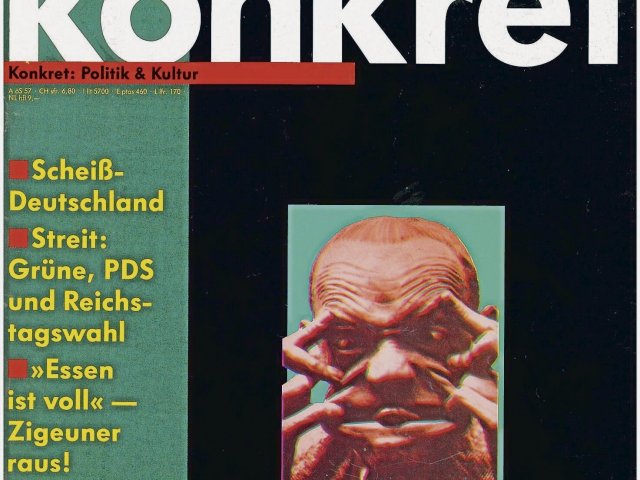»Mein Patient war der Ostbürger«
Wolfgang Stumph hat am 3. Oktober »Heimweh nach drüben«
Stumpf: Sehnsucht nicht, weder ich noch er. Stefan Busemann war ja kein glücklicher DDR-Bürger. Der hatte Sehnsucht nach Heimat, die für ihn vor allem Liebe bedeutet, in dem Fall zu einer Frau, zu seinem Freundeskreis. Was ihm fehlt, ist nicht DDR, sondern ein Landstrich, Menschen, Arbeit, Familie. So ergeht es mir auch und ich will den gebrauchten Bundesländern einen Heimatbegriff zeigen, der deutlich macht, warum nicht alle aus den neuen fortgelaufen sind.
Schämen sich ehemalige DDR-Bürger noch ihrer Heimatgefühle?
Das ist eine Frage der Perspektive. Die Mediengesellschaft derjenigen, die auf der richtigen Seite gelebt haben, fördern seit jeher die Sichtweise: Wie habt ihr das da bloß aushalten können? Dabei ist das einzige Glücksverdienst der anderen Seite die Geburt an richtiger Stelle. Er reicht allerdings aus, um ehemaligen DDR-Bürgern ein schlechtes Gewissen zu verabreichen und einen simplen Satz zu einer Rechtfertigung werden zu lassen: Ich hatte auch glückliche Mo-mente - als unser Kind kam, als wir Dachziegel aufgetrieben haben oder nach zwölf Jahren unseren Trabi. Dass dann schnell der Vorwurf kommt, man wolle die DDR zurück, trampelt auf vielen Jahren gelebter Biografie herum.
Ihre Botschaft lautet?
Habt Verständnis, dass nicht 17 Millionen abgehauen sind! Dass kleine Bürger auch ein Recht auf Heimatgefühl haben. Es ist ein Werben für die Folgen der Liebe.
Sind Sie eher der Typ, der bleibt um zu verändern, oder der geht, wenn dies unmöglich scheint?
Ich habe eine gewisse Bodenhaftung, zunächst zu meinen künstlerischen, moralischen Ansprüchen. Da lasse ich mich nur von mir selbst beeinflussen und lasse mich nur von meinem Verstand und meinem Gefühl leiten. Ich bin eine Klette, fast penetrant treu.
Sie hatten nie Fluchtgedanken?
Nein. Ich war Kabarettist, dessen Grundgedanke es ist, über die Kritik verändern zu wollen. Ein Kabarettist fühlt sich immer wie ein Arzt, der die Beschwerden kennt. Und mein Patient war nicht der Bundes-, sondern der Ostbürger, dort wollte ich etwas bewegen, dort wollte ich mich auf der Bühne über die Widersprüche unseres Lebens auskotzen. Wenn ich mir was Bequemeres hätte suchen wollen, wäre ich etwas anderes geworden.
So gesehen muss die DDR doch ein gutes Pflaster für Kabarettisten gewesen sein?
Selbstverständlich, Regime insgesamt, wenn auch ein gefährlicheres. Aber ich konnte doch auch nicht egoistisch meine Familie im Stich lassen, meine Freunde. Wenn ich hätte fliehen müssen, wäre das was ganz anderes gewesen. Repressalien verleiten einen erst zum Hass und dann zur Flucht.
Ist die deutsche Gegenwart ein gutes Pflaster fürs Kabarett?
Auch, aber es macht nicht mehr so viel Spaß, weil es keinen Mut erfordert: Alles geht. Man kann jeden kritisieren und die Kritisierten sind sogar traurig, wenn man sie im Karneval nicht bedenkt. Die Spaßgesellschaft kriecht in alle Kunstformen. Dann betrete ich lieber das mutigere Pflaster im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und verbreite Kraft dessen, was ich erreicht habe, zeitgeistige Kritik in Filmform.
Seit wann sind wir so weit, über die DDR lachen zu können?
Bei aller Bescheidenheit: Seit dem 17. Januar 1991, als die Sachsen im Trabi über Regens-burg nach Neapel kamen - so wie Goethe damals mit der Kutsche.
Die Premiere von »Go, Trabi, Go«.
Genau. Danach war lange Jahre Ruhe. Ein vernachlässigtes Feld.
Wegen verletzbarer Befindlichkeiten?
Selbstverständlich. Man kann keine Komödie über den 9.11. machen, aber ich bin der Meinung über uns selbst muss lachen möglich sein. Ich fasse meine Rolle als Menschendarsteller und nicht als Versteller auf.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.