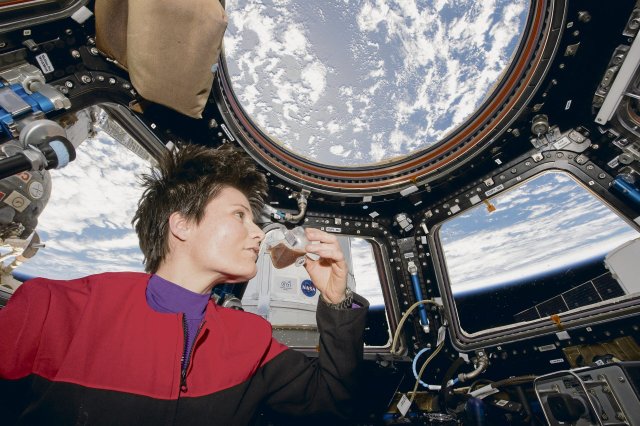- Wissen
- Lichtverschmutzung
Dunkel war’s – die Nacht scheint helle
Einem Citizen-Science-Projekt zufolge ist die Lichtverschmutzung in den letzten Jahren exponentiell gewachsen

Beim Blick in die städtische Nacht fällt schnell auf, dass nachts schon lange nicht mehr alle Katzen grau sind und das Sternezählen zu einer sehr kurzen Angelegenheit wird. Lichtverschmutzung erhellt in weiten Teilen der Welt die Nächte – mit steigender Tendenz, wie eine neue Studie darlegt. Sterngucker haben es schon lange bemerkt, und auch Spinner, Spanner und Schwärmer (drei der verbreitetsten Nachtfalterarten in Deutschland) haben es längst erfahren müssen: Die Nacht wird immer heller.
Das internationale Projekt »Globe at Night« ist eine Citizen-Science-Kampagne, die Freiwillige weltweit einlädt, ihre Beobachtungen des Nachthimmels zu messen und einzureichen. Die Projektteilnehmer bekamen dazu einen Satz von Karten des Nachthimmels mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten von Sternen vorgelegt und wählten jene Abbildungen, die den mit bloßem Auge betrachteten Himmel an ihrem Standort am besten darstellten.
Seit Beginn der Studie im Jahr 2011 wurden mehr als 51 000 Einzelbeobachtungen zusammengetragen und von Geowissenschaftlern und Astronomen aus Deutschland und den USA ausgewertet. In der nun veröffentlichten Analyse des Projekts zeigt sich deutlich, dass die Helligkeit des Nachthimmels, hervorgerufen durch künstliche Lichtquellen, im Beobachtungszeitraum weltweit exponentiell anstieg, mit fast zehn Prozent pro Jahr. Der auch als »Lichtverschmutzung« bezeichnete Effekt entsteht dabei durch Licht, das an Schichten der Atmosphäre, an Molekülen, Aerosolen, Stäuben und Wasserdampf reflektiert und gestreut wird und so den gesamten Nachthimmel gleichmäßig erhellt.
Satelliten nehmen LED-Licht nicht wahr
Satellitenaufnahmen der gesamten Erde haben zwar ebenfalls einen Trend seit Jahren steigender Nachthelligkeit dokumentiert – jedoch in einem deutlich geringeren Umfang. Die Diskrepanz zwischen Satelliten- und Sternguckerdaten ist dabei hauptsächlich auf die Sensitivität der Satelliten zurückzuführen sowie seit einigen Jahren auf die vermehrte Nutzung von LEDs. So können die momentan eingesetzten Satelliten nur Wellenlängen zwischen rund 500 und 900 Nanometer detektieren, was grün-bläulichem bis rotem Licht entspricht. LEDs, insbesondere solche mit »kaltem« Licht, haben ihr Leuchtmaximum jedoch meist im kürzeren Wellenlängenbereich (400 bis 500 Nanometer), teilweise auch noch im nahen Ultraviolettbereich, was die Satellitensensoren größtenteils schlicht »übersehen«.
Wir – und so ziemlich alles, was in der Natur so kreucht, fleucht und kaum noch ruhig schlummern kann – registrieren jedoch ein stetig zunehmendes diffuses Himmelsleuchten in der Nacht, auch »Airglow« genannt, das große Städte wie eine Lichtkuppel umgibt und den Himmel noch bis zu 50 Kilometer weit erhellen kann. Hinzu kommen Beleuchtungen von Straßen und Autobahnen; auch Autos tragen mit ihrem Fernlicht zur Erhellung der Nacht bei. Bei einer solchen Reichweite der städtischen Lichtverschmutzung wird schnell klar, dass sich im dicht besiedelten Europa kaum noch gut im Dunkeln der Himmel beobachten lässt. Auf Internetseiten wie lightpollutionmap.info kann man sich interaktiv über die Dunkelheit von Orten weltweit informieren, wobei oft die Bortle-Skala zur Bestimmung des Grades der Lichtverschmutzung genutzt wird.
Neun Güteklassen der Dunkelheit
John Bortle teilt die Dunkelheit des Himmels in neun Güteklassen ein, veröffentlicht 2001 im Magazin »Sky & Telescope«. Unter einem Nachthimmel erster Klasse sieht man im wahrsten Sinne die Hand vor den Augen nicht: Instrumente oder Mit-Sternengucker sind vor dem dunklen Hintergrund nicht mehr zu erkennen, und unsere Nachbarplaneten Venus oder Jupiter strahlen so hell (Neumond vorausgesetzt), dass die Dunkeladaption des Auges behindert wird. Die Dunkelheit erstreckt sich bis zum Horizont, Tausende Sterne, eine leuchtende Milchstraße und sogar das Zodiakallicht – ein diffuser Lichtkegel, der durch Reflexion von Sonnenlicht an kosmischem Staub entsteht, – bringen Nachthimmel und die Augen der Sterngucker zum Strahlen. Extreme Dunkelheit findet sich meist nur noch in sehr abgelegenen trockenen Wüsten- oder Gebirgsregionen.
Ganz am anderen Ende der Skala liegen die Innenstädte (Klasse 9), in denen der gesamte Nachthimmel bis zum Zenit weiß-gelblich erleuchtet ist. Die Milchstraße ist schon seit dem ersten Einbiegen in die Hauptstraße der hellen Vorstadt nicht mehr sichtbar, und der Himmel erscheint nun zu großen Teilen sternenlos. Auch die bekannten Sternbilder haben Lücken, nur die hellsten Sterne der auffälligsten Konstellationen sind noch auszumachen.
Und doch gibt es auch in Deutschland einige Orte, an denen einem noch recht schwarz vor Augen und Teleskop werden kann: Der Sternenpark Rhön etwa wurde im Jahr 2022 von der International Dark Sky Association als weltweiter »Sternenpark des Jahres« ausgezeichnet und lässt Besucherinnen und Besucher einen sternenvollen Himmel erleben. In Brandenburg teilen sich im Natur- und Sternenpark Westhavelland Kampfläufer (Wappentier des Parks und streng geschützter Schnepfenvogel) und friedliche Sterngucker die finstere Nacht, und ganz im Süden Deutschlands, auf der Winklmoos-Alm in den Chiemgauer Alpen, gibt es ganz lichtunverschmutzt jede Menge Stars und Sternchen zu beobachten.
Jetzt liegt es an Städteplanern, Werbetafelbetreibern und auch ein bisschen an jedem Einzelnen, mit Garten- oder Balkonbeleuchtung, wieder etwas mehr Dunkel in das ganze (Streu-)Licht zu bringen.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.