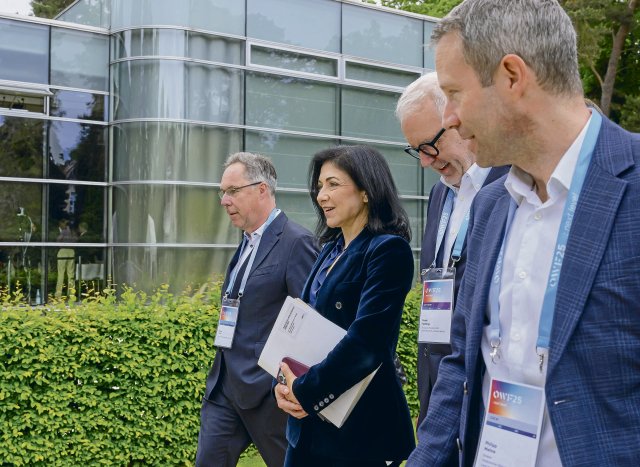- Politik
- Migration in die USA
»Der American Dream ist tot«
Von Mauretanien via Nicaragua in die USA: Tausende folgten dieser Route, um sich ein neues Leben aufzubauen. Doch Trump lässt diesen Traum platzen

Es begann mit Tiktok. »Das ist die neue Route hin zum amerikanischen Traum, ohne den Darién-Gap durchqueren zu müssen«, verspricht ein Video mit einer animierten Landkarte Amerikas im Hintergrund. In anderen Videos unter den gleichen Hashtags filmen sich junge Menschen in Bussen, auf Waldwegen und schließlich vor der »Trump Wall«.
Durch Social-Media-Videos wie diese verbreitete sich in Mauretanien zuletzt eine Route in Richtung USA: aus Mauretanien per Flug über die Türkei nach Nicaragua. Ein Ausgangspunkt, von wo aus sich aufgrund der niedrigschwelligen Einreisebedingungen die Reise über Land fortsetzen ließ. Auf dieser Route müssen die Migranten nicht den gefährlichen Weg durch den Dschungel in der panamaischen Region Darién wählen, wie viele Flüchtende aus Südamerika. Über die letzten rund drei Jahre hinweg machten sich so mehrere tausend Mauretanier*innen auf den Weg an die mexikanisch-US-amerikanische Grenze.
»Eine Auswanderungswelle dieses Ausmaßes ist bisher beispiellos für Mauretanien«, sagt der mauretanische Anthropologe Elhadj Ould Brahim, der für die Fondation Maison des Science de l’Homme in Paris forscht. Auch das Ziel sei neu gewesen. Historisch, so Brahim, habe sich Migration vor allem zu Handelszwecken auf Nachbarländer und den afrikanischen Kontinent fokussiert. In der jüngeren Vergangenheit seien besonders die Golfstaaten oder Europa attraktiv gewesen. Richtung USA hätte sich zuerst die Mittelschicht aufgemacht, sagt er. Diejenigen, die die rund 10 000 US-Dollar für die gesamte Route überhaupt aufbringen konnten. Seitdem verkaufen nicht selten Menschen ihr Hab und Gut, um eine solche Reise antreten zu können.
2022 wurden durch US-Beamte lediglich 543 Mauretanier*innen offiziell an der Grenze erfasst. 2023 explodierte diese Zahl dann auf über 15 000. Einer davon war Hamed.
Nachdem er von einem Freund in den USA praktische Informationen erhalten hatte, flog der heute 28-Jährige von Mauretanien aus über die Türkei nach Spanien, von dort nach Kolumbien und El Salvador, und landete schließlich in Nicaragua. Gemeinsam mit 20 weiteren Mauretanier*innen reiste er weiter über Land, in Autos, die von den jeweiligen Schmugglern organisiert wurden. Eine riskante Reise, wie er selbst sagt. »Ich hatte Angst. Manchmal habe ich mich gefragt, warum ich hier gerade mein Leben aufs Spiel setze«, gesteht er. »Aber dann war mir klar, dass ich das jetzt zu Ende bringen muss.«
Die Schmuggler seien bewaffnet gewesen und vor allem in Mexiko sei ihnen mehrfach von Polizisten Geld abgenommen worden. »Die durchsuchen dich und nehmen, was sie finden«, erzählt Hamed. Um nicht mittellos zu stranden, hätten sie vorausschauend Teile ihrer Reserven vor der Polizei verstecken müssen. Aber dann wurden sie entführt. Auf offener Straße seien die beiden Reisebusse voll mit nordafrikanischen Migranten von Pick-ups umstellt worden. Während er selbst und weitere Männer rechtzeitig hätten fliehen können, seien andere als Geiseln in die Wüste verschleppt worden. »Die Geiselnehmer haben 10 000 Dollar von den Familien verlangt, die sie per Western Union schicken sollten«, erinnert sich Hamed. Da er selbst neben Arabisch und Englisch auch etwas Spanisch sprach, wurde er per Handy zum Vermitteln herangezogen. Nach ein paar Tagen seien die Gefangenen dann schließlich freigelassen worden. Die Erinnerung jedoch lässt Hamed noch immer nicht los.
In New York hat er schließlich Arbeit in einem Amazon-Lagerhaus gefunden. Es sei eine Menge Arbeit, aber hier könne er ausreichend Geld verdienen, um seine Familie in Mauretanien finanziell zu unterstützen, meint der ehemalige Flugzeugmechaniker. Das Gehalt seines Vaters daheim reiche nicht aus, um die Kosten für den Alltag und die Bildung seiner sechs jüngeren Geschwister zu stemmen. Seine beiden freien Tage verbringt Hamed meistens damit, für den Dienstleister Uber zu fahren. Er hofft darauf, eines Tages genügend Geld gespart zu haben, um seinen eigenen Deli zu eröffnen, wie er die kleinen Nachbarschaftsläden nennt. Eine Businessidee, die viele seiner Landsleute teilen.
Hameds Geschichte ist kein Einzelfall – während sich diese Route in die USA in Mauretanien herumsprach, verlor Präsident Mohamed Ould Ghazouani in der Hauptstadt Nouakchott zunächst wenige Worte darüber. Fast zwei Jahre lang habe die Regierung die Situation totgeschwiegen, sagt Brahim. »Allem liegen schließlich wirtschaftliche und soziopolitische Dynamiken zugrunde. Das lässt sich auch auf ein Regierungsversagen zurückführen.«
Die Gründe für Mauretanier*innen, anderswo ein Leben aufbauen zu wollen, seien vielfältig, erklärt der Forscher. Neben Armut und finanziellen Schwierigkeiten spielten vor allem Diskriminierung und die Bedrohung persönlicher sowie gesellschaftlicher Freiheiten eine zentrale Rolle. Das Spektrum reiche von Rassismus und Heiratsregelungen über Sklaverei und die Diskriminierung sexueller Minderheiten bis hin zu juristischer und politischer Verfolgung – etwa aufgrund mutmaßlicher Blasphemie oder Präsidentenbeleidigung. »All das können Gründe für eine Verfolgung sein«, so Brahim.
An die Grenzen der Meinungsfreiheit in Mauretanien ist der Rapper JPS nur allzu oft gestoßen. Bevor er sich vor einem Jahr auf den Weg nach Nicaragua machte, verdiente der heute 24-Jährige sein Geld in der Millionenstadt Nouakchott als Fahrer einer Autorikscha. Nebenbei arbeitete er an seiner Rap-Karriere. Sein Lied »3ne Mauritanie« von 2019 hat auf Youtube 45 000 Views. »Die Menschen heute sind verloren und wissen nicht, was tun/ Eine ungerechte Herrschaft und die Bürger haben kein Mitspracherecht/ Der Name des Verbrechers ist Aziz«, kritisiert er darin den Staat und den Ex-Präsidenten Mohamed Ould Abdel Aziz. Statements, wie diese brächten negative Konsequenzen mit sich, meint er. Welche genau, darüber möchte der Künstler nicht sprechen.
Von vielen Themen, die er in seiner Musik hatte verarbeiten wollen, hätten ihm andere von vornherein abgeraten. Weibliche Beschneidung etwa oder Kinderehen. »Um Probleme zu vermeiden«, sagt er. Als politischer Künstler bereitet er in den Vereinigten Staaten mithilfe eines Anwalts nun seinen Asylantrag vor. Währenddessen macht er in New York eine dreimonatige Fortbildung, um auf dem Bau arbeiten zu können. Und er arbeitet an seinem neuen Album. »Jetzt kann ich mich endlich frei ausdrücken und aufklären«, sagt er. »Ohne Angst und ohne mich zu verstecken.«
Neben New York ist die Stadt Cincinnati im Bundesstaat Ohio ein Hauptanlaufpunkt für die mauretanische Community. Viele, die hier ankommen, vertrauen auf die Solidarität ihrer Landsleute. In der Wohnung seiner Eltern hätten sie eine Zeitlang bis zu zehn Neuankömmlinge aufgenommen, erzählt Seiny Ball. In dem Fünf-Personen-Haushalt sei der Platz allerdings so knapp geworden, dass der 29-Jährige schließlich eine zusätzliche Wohnung gemietet habe. »Um ihnen auf die Füße zu helfen«, sagt er. »Zumindest bis wir ihren Papierkram erledigen und einen Job finden konnten.« Arbeit gebe es. Viele Firmen suchten schließlich Arbeitskräfte. Er selbst hatte zuerst ein Jahr lang in einer Hühnchenfabrik gearbeitet, in der viele Migrant*innen Anstellung fänden. Die Lärmbelastung sei für den sensiblen Mann jedoch auf Dauer zu viel gewesen. Jetzt arbeitet er als Fahrer, über die Fahrdienstvermittler-App Lyft. Zehn, manchmal zwölf Stunden am Tag. Aber es komme Geld dabei rum, sagt er. Genug, um die Lebenshaltungskosten für sich selbst und seine Mitmenschen zu decken.
»Eine Auswanderungswelle dieses Ausmaßes ist bisher beispiellos für Mauretanien.«
Elhadj Ould Brahim Anthropologe
Als er sich vor drei Jahren dazu entschlossen hatte, per Familiennachzug seinem Vater zu folgen, spielte für ihn Geld keine entscheidende Rolle. Es war vielmehr das gesellschaftliche Klima in Mauretanien, das ihn einschränkte. Als schwarzer Mann fühlte er sich in der maurischen Mehrheitsgesellschaft oft diskriminiert. Er erzählt von Polizisten, die ihm gegenüber gewalttätig wurden, als er eines Abends mit seinen Freunden am Strand saß, um gemeinsam Tee zu trinken. »Um nur ein Beispiel zu nennen«, sagt er.
Mit Donald Trumps Rückkehr als Präsident hat sich die Situation grundlegend geändert. Bereits an seinem ersten Tag im Amt rief der US-Präsident den nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko aus und unterzeichnete mehrere Dekrete zur Migrationsabwehr. So ordnete er eine verstärkte Militarisierung im Grenzgebiet an: Zusätzliche Truppen wurden entsandt, und im vergangenen Monat wurde dort der erste Teil einer militärischen Pufferzone eingerichtet.
Trump setzte zudem bis auf Weiteres das Asylrecht an der Grenze aus. Einreisen mit dem Ziel, in den USA Asyl zu beantragen, sind damit aktuell nicht mehr möglich. Bereits im März war die Zahl der versuchten irregulären Grenzübertritte bereits auf den niedrigsten Stand seit Beginn der staatlichen Erfassungen gesunken. Seit Trumps Wiederwahl höre man kaum von Mauretanier*innen, die es noch in die USA geschafft haben, sagt Brahim. Einige seien erst mal in Mexiko gestrandet.
Aber wer sich bereits in den USA aufhält, habe gute Bleibeperspektiven. »Die Gruppe der Mauretanier steht aufgrund ihrer vergleichbar geringen Größe aktuell nicht im Fokus von Abschiebekampagnen«, sagt er. Ansonsten dauere es in der Regel Jahre, bis über einen Asylantrag entschieden werde. Während dieser Zeit hätten viele bereits einen Job gefunden und seien dabei, sich ein Leben aufzubauen.
JPS, Seiny und Hamed lassen sich derweil nicht verrückt machen. Eine baldige Abschiebung fürchtet keiner der drei. Manchmal höre man Gerüchte über Mauretanier*innen, die abgeschoben worden seien, sagt Hamed. Aber er vertraue auf das Einwanderungsrecht. »Gesetze kann man so schnell nicht ändern«, meint er. Wie er verweisen auch JPS und Seiny auf den Schutzstatus ihrer Kommunen, sogenannte »Sanctuary Cities«. In diesen »Zufluchtsstädten« gilt durch lokale Richtlinien nur eine eingeschränkte Pflicht zur Kooperation mit den Bundeseinwanderungsbehörden.
Selbst falls es eines Tages wieder möglich sein sollte, sagt Hamed, habe er seinen eigenen Geschwistern jedoch davon abgeraten, die Odyssee jenseits des Atlantiks anzutreten. »Ich habe ihnen gesagt, dass der American Dream tot ist«, meint er. Mit etwas Glück könnten sie es auch in Mauretanien zu etwas bringen. Und sollten sie sich eines Tages doch dazu entschließen, in die USA auszuwandern, dann nur auf legalem Weg, hofft der große Bruder. »Ich will nicht, dass sie durchmachen müssen, was ich erlebt habe.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.