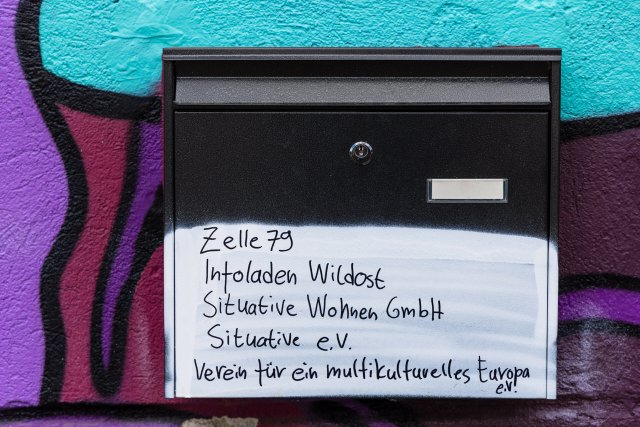- Berlin
- Keramikmuseum
Velten: Wo Patina Geschichte transportiert
Das Ofen- und Keramikmuseum zeigt: Ohne den Ton im Boden hätte es die Brandenburger Industrie und die Metropole Berlin nicht gegeben

Die goldgelben Klinker des Ofen- und Keramikmuseum Velten strahlen in der warmen Augustsonne. Ein imposanter Backsteinbau aus dem Jahr 1899. Seit 2016 werden an diesem denkmalgeschützten Ort keine Kacheln mehr gebrannt. Eine Patina aus Tonklecksen und Ruß haftet auf Ziegeln und Maschinen, erzählt von mehr als 100 Jahren Industriegeschichte. Museumsteam und Engagierte beleben und erhalten hier 9000 Quadratmeter Fabrikgelände.
Am 9. August, dem dritten »Tag der Industriekultur« in Brandenburg, stellte das Museum ein buntes Programm auf die Beine. Radtour, Töpfern, Brettspiele, Harfenkonzert und Führungen – möglich nur dank vieler Ehrenamtlicher. Der lebendige Ort ist etwas Besonderes und wurde deshalb für die Eröffnung des Tages ausgewählt. Fast 30 weitere Standorte öffneten ihre Türen: vom Besucherbergwerk F60 in der Lausitz über die Baruther Glashütte bis zum Eisenbahnmuseum Gramzow in der Uckermark. Viele Schauplätze sind stillgelegte Werksgelände.
In Velten heißt es beim »Pötterfrühstück«: Ohne den Ton unter den Füßen der Brandenburger wären Orte wie dieser nicht zu Industriezentren geworden – und Berlin nicht zur Metropole. Schmalz- und Leberwurstbrote sowie Kaffeesahne werden auf Geschirr im Stil der lokalen Berühmtheit und Keramikerin Hedwig Bollhagen gereicht. Am Büfett verweist das Design des grün glasierten Serviettenhalters auf das Produkt, um das sich hier alles dreht: Ich befinde mich an der Geburtsstätte des berühmten Berliner Kachelofens. Ohne den hätten die Hauptstädter der letzten zwei Jahrhunderte gefroren.

nd.Muckefuck ist unser Newsletter für Berlin am Morgen. Wir gehen wach durch die Stadt, sind vor Ort bei Entscheidungen zu Stadtpolitik – aber immer auch bei den Menschen, die diese betreffen. Muckefuck ist eine Kaffeelänge Berlin – ungefiltert und links. Jetzt anmelden und immer wissen, worum gestritten werden muss.
Bei ruhig-sommerlicher Stimmung verteilen sich kleine Grüppchen auf dem weitläufigen Gelände. Vereinsmitglieder erkennt man an ihren bedruckten T-Shirts – ausgeblichen von zahlreichen Arbeitseinsätzen. Sie schieben Getränkekarren, richten das Büfett her und erzählen von Grillabenden und Renovierungen. Der engagierte Förderverein trägt den Standort, vernetzt sich mit Keramik- und Ofenfreunden im ganzen Land. Ein besonderer Erfolg: 2023 wurde der traditionelle Kachelofenbau – maßgeblich durch Veltener Einsatz – als immaterielles Kulturerbe anerkannt. In der Keramikwelt gilt Velten längst als feste Größe.
Schon seit 1905 gibt es an diesem Standort ein Museum, zunächst mit dem Ziel, die zeitgenössische Technik zu dokumentieren und zu präsentieren. Als Rolf Schmidt, letzter Inhaber der Firma A. Schmidt, Lehmann & Co. GmbH, 2016 den Betrieb einstellte und entschied, das Gelände zu verkaufen, traf das den Museumsverein wie ein Schock. Erst fuhren dicke Autos vor – man befürchtete Luxuslofts statt gemeinschaftlicher Bauhütten und Kulturvermittlung. Aber: Auch Schmidt lag etwas an seinem Stück Industriegeschichte. Schließlich ermöglichten Gelder aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR den Kauf. Die Gelder sind vom Land Brandenburg für gezielte Investitionen in wirtschaftliche, soziale und kulturelle Projekte vorgesehen.
Ohne Menschen wie den Fördervereinsvorsitzenden Udo Arndt wäre das anders gekommen. Auf eine Krücke gestützt und mit gehäkeltem Glückskleeblatt am schwarzen Revers steht er inmitten der Baustelle des zukünftigen Schornsteinfegermuseums. Wie eine Handvoll Vereinsmitglieder ist er so gut wie jeden Tag hier. Arndt stammt eigentlich aus Berlin. 1992, kurz nach der Wende, entdeckten er und seine Frau eine Zeitungsanzeige: In der Veltener »Sportlerklause« solle ein Förderverein für das Ofen- und Keramikmuseum gegründet werden. Die Arndts, seit den 80ern im Handel mit antiken Öfen, kannten die Szene – und den Ort. Sie setzten sich ins Auto. »Die Stadt Velten hatte damals andere Sorgen als ein Museum«, sagt Arndt.
Seitdem ist das Grüppchen aus der »Klause« zu einem Förderverein mit knapp 200 Mitgliedern herangewachsen. Mit nur drei Festangestellten halten sie die Ofenfabrik in Schuss. Die meisten von ihnen: Rentner. »Naturgemäß«, sagt der Vorsitzende, für dieses Arbeitspensum habe sonst kaum wer Zeit. Sie reisen aus Velten, Berlin, dem Brandenburger Umland und dem gesamten Bundesgebiet zu regelmäßigen »Subbotniks« an: schleppen Schutt, schleifen Stahlträger oder putzen Fenster. Kürzlich hat man sogar eine alte Dampfmaschine von 1892 für die Museumsräume gemeinschaftlich saniert. Wer nicht selbst Hand anlegen will, kann für 10 Euro eine Ziegelpatenschaft übernehmen; für 1200 Euro gibt es ein ganzes Fenster.
Museumsleiterin Nicole Seydewitz erklärt das Renovierungskonzept: Der Charakter des Ortes soll erhalten bleiben. Man setzt auf unverfälschte Patina und ursprüngliche Materialien. Einige davon aus der Nachbarschaft: Als in der Gemeinde ein Gehweg aufgelöst wurde, fielen 30 000 Originalklinker des späten 19. Jahrhunderts an und wurden in die Sanierung integriert. Andersrum dient auch die Fabrik als Ersatzteillager für den letzten Baukeramikbetrieb des Ortes.
Alte Industriestandorte durch den Strukturwandel zu begleiten und ein nachhaltiges Zukunftskonzept zu realisieren, ist nicht immer einfach. Die Nutzung für Kultur und Events ist die sicherste Strategie, um sie für die Öffentlichkeit zugänglich zu halten. Diese »Fremdnutzung« wirke aber schnell aufgesetzt, findet Udo Arndt. »Notgeburten« seien das meistens. »Dafür wurde das Gebäude nun mal nicht gebaut!« In Velten ist das Experiment augenscheinlich geglückt.
Im Hof haben sich schmale Birken durch Spalten im Beton gekämpft und dürfen trotz Sanierung bleiben. Bei Familienfeiern und Firmenevents werden Gäste bald kühle Getränke unter ihren Laubdächern genießen. Für das Schornsteinfegermuseum konnte eine Kooperation mit dem örtlichen Standesamt festgemacht werden. »Hochzeiten brennen sich ins Familiengedächtnis ein«, beschreibt Udo Arndt eine der Ideen dahinter: Wenn die Eltern hier geheiratet haben, dann bleiben womöglich auch die Kinder dem Ort verbunden. Kein Nebeneffekt: Die Vermietungen sollen Betriebskosten und die nächste Sanierung auf sichere Beine stellen.

Andreas Bree und Kerstin Budig stehen vorm Eingang der alten Brennkammer am Grill und reichen Bratwurst mit Senf. Andreas Bree, seit 1995 im Verein, zählt hiert zu den »Ur-Veltenern«. Das sei heute nicht mehr die Masse, aber einen harten Kern gebe es. Ob man in Velten stolz auf den historischen Museumsstandort ist? Herr Bree winkt lachend ab: »Wenn jeder einen Euro spenden würde, vielleicht.« Schon in Ordnung, es gibt ja Arndt, der alle Fördertöpfe kennt. Zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Finanzen stammen inzwischen von privaten Unterstützern aus dem ganzen Bundesgebiet. Der Standort ist längst kein Lokalprojekt mehr.
Der letzte Hausmeister der Fabrik legt heute noch Kabel und streicht Wände – damit ist er klar die Ausnahme. Wo man sein ganzes Leben gearbeitet hat, muss man heute nicht seine Freizeit verbringen, finden viele ehemalige Beschäftigte. Der Chef-Ehrenamtliche Arndt zuckt mit den Schultern: »So ist das. Der eine ist stolz – der andere ist froh, dass er es hinter sich hat.« Auch wenn er selbst dem Handwerk und dem Ort leidenschaftlich verbunden ist, will er von Nostalgie nichts wissen. Ob zu Hause oder im Betrieb: Die Arbeiter mussten viel Holz schleppen, damit kein Ofen ausging. So manch eine Fabrik brannte in den letzten 150 Jahren ab. Harte Zeiten damals. Für den Rentner ist ein Bewusstsein für diese Arbeit und ihre qualitativ hochwertigen Produkte wichtig. Letztendlich setze das Maßstäbe für die Gesellschaft: Sorgsamkeit, erhalten, was gut ist, Erfolg durch gemeinsamen Einsatz.
Das Museum ermöglicht auch einen Blick in die gesellschaftlichen Verhältnisse des 20. Jahrhunderts. Hier stehen einfachste Öfen für die kleine Wohnung eines Arbeiters neben prunkvoll verschnörkelten Luxusmodellen inklusive Engelchen und floralem Muster. Darin zeigen sich extreme Klassenunterschiede.
Durch die Fabrikhalle schallt dumpf das Geräusch von auf Tischplatten klatschenden Tonklumpen. Beim Umgang mit dem Material soll Kindern vermittelt werden, dass der Ton im Boden ihre Stadt geschaffen hat. Regelmäßig kommen Schulklassen. Bei 36 Ofenfabriken im Ort gab es in jeder Familie irgendjemanden, der in der Keramikindustrie arbeitete. »Um zu verstehen, wie wir heute leben, müssen wir wissen, wo wir herkommen«, erklärt Sindy Brandt, Projektkoordinatorin vom Touristischen Netzwerk Industriekultur, die Basis der Museumspädagogik. Manuela Gander vom Museumsverband hebt die Designs von Hedwig Bollhagen (kurz: HB) als besonders identitätsstiftend hervor. Ihre eigenen Küchenschränke sind gefüllt mit den Designs: »Ich oute mich als großer Fan!« In der ehemaligen Schlosserei der Fabrik ist »HB« ein eigenes Museum gewidmet.
»Um zu verstehen, wie wir heute leben, müssen wir wissen, wo wir herkommen.«
Sindy Brandt Projektkoordinatorin
Doch zur Auseinandersetzung mit Industriegeschichte gehört auch die Frage nach dunklen Seiten: Armut, Ausbeutung, Zwangsarbeit. Im Nationalsozialismus soll Hedwig Bollhagen von Zwangsarbeit profitiert haben. Ein Gutachten des Zentrums für Zeithistorische Forschung untersuchte 2008 ihre Rolle bei der Arisierung des Betriebs.
Gander sieht die Auseinandersetzung mit der Realität der Arbeiter und der NS-Zwangsarbeit als zentrale Aufgabe. Heute muss sie jedoch um Geduld bitten. Erst vor Kurzem wurde auf Initiative der AG »Industriekultur im Museum« ein Fragebogen an alle Standorte geschickt. Die Ergebnisse werden nun ausgewertet. So viel sei gesagt: Viele sind in ihren Archiven und Sammlungen fündig geworden, Einzelne haben bereits dazu gearbeitet.
In Velten selbst gibt es kein spezielles Archiv zur Recherche. Aber: Dank Ordnern der evangelischen Gemeinde konnte im vergangenen Jahr der Schüler Jakob Krieg im Rahmen eines Schulprojektes das Schicksal zweier Zwangsarbeiter rekonstruieren. 1944 wurden sie am Tonberg öffentlich vor den Augen anderer Häftlinge gehängt. Er initiierte eine Gedenkveranstaltung vor Ort.
Udo Arndt erinnert an den Zweiten Weltkrieg als das Ende der Keramikblüte in Velten. Bis in die 1930er florierte die Industrie. Nach dem Krieg dann Verstaatlichung in der DDR und Massenproduktion. Mit der Wende ein weiterer Bruch: Volkseigene Betriebe (VEB) wurden geschlossen oder verkauft, Jobs verschwanden. Ein Ortsansässiger ärgert sich: Früher konnten junge Leute überall Berufe lernen. »Wäre ja ein Wunder gewesen, wenn man mal was Gutes aus der DDR übernommen hätte!«
Heute versuchen vielerorts kleinere Betriebe, das Handwerk wieder aufleben zu lassen. Spezialisierte Werkstätten stellen mit viel Sachverstand Öfen und Keramik her, wie es überliefert ist. In Velten vernetzt man sich und tauscht sich aus. »So haben die eine Chance gegen die Massenproduktion«, sagt Udo Arndt.

Die Begegnung an Orten wie dieser Ofenfabrik ist wichtig. »Das war hier Teil unserer Kultur!«, sagt der Vereinsvorsitzende. »Es ist doch so: Wir sind an dem letzten Punkt, an dem wir noch einen Zipfel dieser Geschichte greifen können, die wir gerade verlieren. Jetzt können wir davon noch etwas erhalten.«
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.