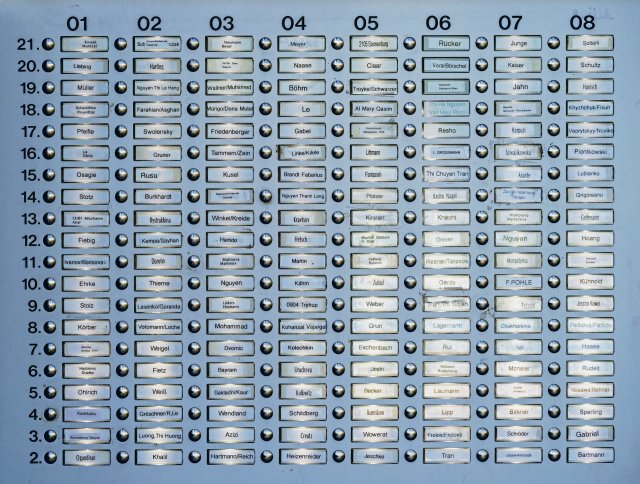- Wirtschaft und Umwelt
- Internationale Umweltpolitik
Freie Bahn für Plastikmüll
Erdölstaaten verhindern Einigung auf verbindliches UN-Abkommen

Die Verhandlungsrunde von rund 180 Staaten über ein UN-Plastikabkommen ist nach zehn Tagen ergebnislos zu Ende gegangen. »Wir werden hier in Genf kein Abkommen erzielen«, sagte der Vertreter Norwegens am Freitagmorgen. Von Indien und Uruguay hieß es ebenfalls, es habe keine Einigung über den zuletzt vorgelegten Vorschlag gegeben.
Die Verhandlungen waren 2022 ins Leben gerufen worden, in Genf sollte der Vertragsentwurf mit halbjähriger Verspätung nun stehen. Offiziell hätte die abschließende Runde am Donnerstag zu Ende gehen sollen, doch mehr als 100 Punkte waren zuletzt noch ungeklärt. Der Leiter des Verhandlungskomitees, Luis Vayas Valdivieso, legte in der Nacht zum Freitag daher einen weiteren überarbeiteten Vertragsentwurf vor. Zahlreiche Delegierte lehnten es jedoch im Plenum ab, das Dokument als Grundlage für ihre Verhandlungen zu nutzen, da es aus ihrer Sicht zu schwach war. Vom Scheichtum Kuwait hieß es dagegen, die Standpunkte von Erdölstaaten seien nicht hinreichend berücksichtigt. »Diese 5. Sitzung wird vertagt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt«, sagte Valdivieso daraufhin. Wann dies geschehen soll, blieb indes offen. Uganda beantragte eine neue Verhandlungsrunde.
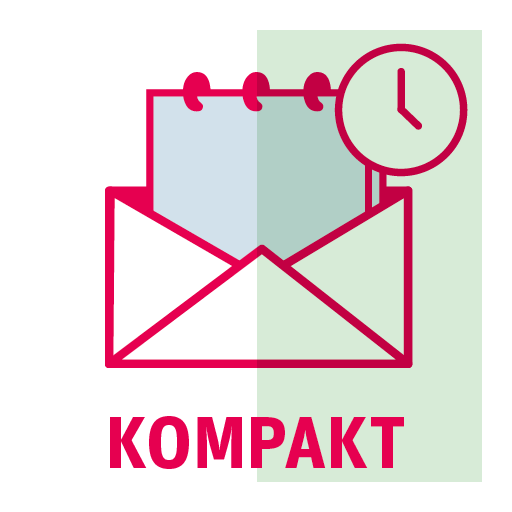
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Seit langem stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: Auf der einen Seite vor allem die Regierungen erdölproduzierender Länder wie Saudi-Arabien, Iran, die Golfstaaten und Russland, die ein möglichst unverbindliches Abkommen anstreben und sich bestenfalls auf ein besseres Abfallmanagement einlassen wollen. Die Trump-Regierung in den USA positioniert sich zudem derzeit gegen jeglichen Multilateralismus. Auf der anderen Seite streben Vertreter von mindestens 130 Staaten, etwa aus der EU, Lateinamerika und Afrika, aber auch von kleinen Inselstaaten einen verbindlichen Vertrag an, der eine Verringerung der Mengen von Neuplastik, Vorgaben für das Produktdesign, eine erweiterte Herstellerverantwortung und die Finanzierung des Aufbaus von Recyclingkapazitäten beinhaltet. Sie erhalten Unterstützung von Wissenschaftlern, Umweltschützern und indigenen Gruppen, die in Genf anwesend waren, aber keinen Zugang zu den offiziellen Verhandlungen hatten.
Beobachter halten eine Verständigung dieser Gruppe mit China und Indonesien nun für wichtig. Diese Länder gehören zu den Hauptproduzenten von Plastik und Plastikabfällen weltweit, haben aber lange, verschmutzte Küstenlinien. »Beide haben hohe Ambitionen signalisiert und betreiben eine engagierte Politik«, sagt Raimund Bleischwitz vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung.
Plastikmüll sorgt weltweit für massive Umweltverschmutzungen, selbst in entlegegen Gegenden ohne Kunststoffproduktion. Potenziell gesundheitsgefährdende Mikropartikel des Abfalls landen auch im menschlichen Körper. Derzeit werden jährlich mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, die Hälfte davon für Einwegprodukte. Weniger als zehn Prozent des Plastikmülls werden recycelt. Bis 2060 könnte sich die Produktion Prognosen zufolge verdreifachen.
Vor allem Länder des globalen Südens kritisierten, dass immer noch kein Abkommen zustande gekommen war. »Wir haben eine historische Gelegenheit verpasst, aber wir müssen weiter machen und dringend handeln«, betonte die Delegation aus Kuba. Der Planet sowie jetzige und künftige Generationen bräuchten dieses Abkommen. »Die Verhandlungen wurden konstant von einer kleinen Zahl von Staaten blockiert, die einfach keine Einigung wollen«, hieß es von Kolumbien. Die Regierung Tuvalus, die in Genf 14 pazifische Inselstaaten vertrat, betonte: »Für unsere Inseln bedeutete das Scheitern des Abkommens, dass ohne globale Zusammenarbeit und staatliche Maßnahmen weiterhin Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Ozeane gekippt werden.« Die Verschmutzung wirke sich auf das Ökosystem, die Ernährungssicherheit, die Lebensgrundlage und die Kultur der Inseln aus.
Als »enttäuschend« bezeichnete das deutsche Umweltministerium das Scheitern. »Augenscheinlich braucht es mehr Zeit, um zum Ziel zu gelangen. Daher lohnt es sich, weiter zu verhandeln«, erklärte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall sagte, Genf habe »eine gute Grundlage« für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen geschaffen.
Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe mahnte hingegen: »Jetzt gilt es umso mehr, auf nationaler Ebene die Umweltauswirkungen von Plastikmüll durch konkrete Maßnahmen einzuschränken und nicht auf die Verabschiedung eines Abkommens zu warten.« Deutschland trage dabei eine besondere Verantwortung, weil hierzulande mit rund 18 Millionen Tonnen die EU-weit größte Menge an Verpackungsmüll verursacht werde.
Als »ökologische Katastrophe« bezeichnete Henning Wilts vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie das Scheitern der Verhandlungen. »Ohne einen geeigneten globalen Rahmen wird es nicht dazu kommen, Investitionen in Richtung einer nachhaltigeren Nutzung von Plastik zu lenken. Stattdessen werden wir den prognostizierten Anstieg der Produktionsmengen und damit auch der Abfallmengen sehen, mit denen auch ein verbessertes Recycling nicht Schritt halten können wird.« Selbst weiten Teilen der Chemie- und Kunststoffindustrie sei bewusst, dass ein »Weiter so« kein tragfähiges Geschäftsmodell sein könne.
»Die progressiven Länder sollten die Zeit bis zur nächsten Verhandlungsrunde gut nutzen, um Bande zu schmieden und sich strategisch besser aufzustellen.«
Melanie Bergmann Meeresforscherin
Nichtregierungsorganisationen fordern derweil, Lehren aus dem »kläglichen Misserfolg« zu ziehen. So sagte David Azoulay vom Center for International Environmental Law, die letzten Tagen hätten gezeigt, dass es unmöglich sei, eine gemeinsame Basis zwischen denen zu finden, die daran interessiert sind, den Status quo zu schützen, und der Mehrheit, die ein funktionsfähiges Abkommen anstrebt. »Wir brauchen einen Neustart. Länder, die einen Vertrag wollen, müssen diesen Prozess nun verlassen und einen Vertrag der Willigen schließen.«
»Die progressiven Länder sollten die Zeit bis zur nächsten Verhandlungsrunde gut nutzen, um Bande zu schmieden und sich strategisch besser aufzustellen, um wirklich ein wirksames Abkommen zu bekommen«, meint Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. »Auch in der Zeit zwischen den Verhandlungen könnte mit Diplomatie viel erreicht und könnten zeitgemäßere Formate für Gespräche gefunden werden.« Die Biologin erinnert an die Verhandlungen zum Landminenabkommen, die die vertragswilligen Parteien außerhalb des UN-Prozesses fortsetzten und zu einer Einigung brachten. Kurz darauf seien auch die wenigen vertragsunwilligen Länder wie die USA und Russland beigetreten. »Etwas in der Art könnte auch hier in Gang gesetzt werden, wobei das Thema Plastik natürlich viel vielschichtiger und komplizierter ist«, so Bergmann.
»Die Welt braucht nicht noch mehr Plastik«, ist NGO-Vertreter Azoulay überzeugt. »Die Menschen wissen das, Ärzte wissen das, Wissenschaftler wissen das und die Märkte wissen das. Die Bewegung zur Beendigung der Plastikverschmutzung geht weiter.« Mit Agenturen
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.