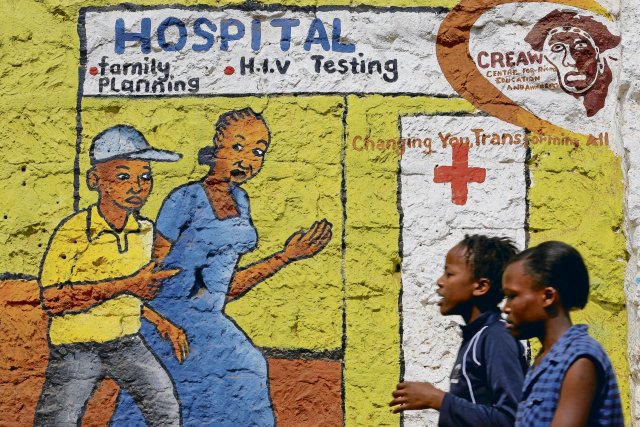- Wirtschaft und Umwelt
- Landnutzung
Ruf nach der Moor-Renaissance
Beratergremium der Regierung empfiehlt eine Milliarde jährlich für natürlichen Klimaschutz

Was hilft in den Augen deutscher Umweltministerien gegen Klimakrise, schwindende Artenvielfalt und die Folgen von Extremwetter? Die Vorgängerregierung verwies dabei auf das »Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz«, auch wenn es im Zuge der Haushaltskrise von anfangs vier Milliarden auf 3,5 Milliarden Euro gestutzt wurde. Auch für den neuen Umweltminister Carsten Schneider (SPD) ist das Programm »essenziell«, wie er kürzlich im Bundestag betonte. »Die Natur gibt uns Menschen so viel«, sagte er noch.
Tatsächlich kann die Natur sehr dabei helfen, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen, indem sie Treibhausgase in großer Menge aufnimmt. Laut Klimaschutzgesetz soll der LULUCF-Sektor im Jahr 2030 mindestens 25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent binden, 2045 schließlich 40 Millionen Tonnen. Das Kürzel steht für »Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft«. Darunter wird erfasst, wie sich Veränderungen in der Landschaft auf die klimarelevanten Emissionen auswirken. Ein verheerendes Beispiel sind derzeit die massiven Waldbrände in Südeuropa.
Intakte Wälder, Moore und naturnahe Landschaften könnten aber auch als CO2-Senken wirken, um schwer vermeidbare Emissionen aus Industrie und Landwirtschaft auszugleichen. Der Wissenschaftliche Beirat für Natürlichen Klimaschutz (WBNK) legte jetzt Empfehlungen vor, was dafür bei der Landnutzung passieren sollte. Der weitaus größte Teil menschengemachter Emissionen stamme zwar aus fossiler Verbrennung, heißt es in dem fast 260 Seiten langen Gutachten. Die intensivierte Nutzung der Landschaft sorge aber ebenso für zunehmende Emissionen, etwa durch trockengelegte Moore. Auch künstliche Gewässer stießen Klimagase aus – in Deutschland zuletzt etwa fünf Millionen Tonnen CO2-Äquivalent jährlich.
Bislang herrschte die Annahme vor, Moore, Wiesen und Wälder seien eine mächtige CO2-Senke. Das Umweltbundesamt rechnete bisher mit jährlich um die 16,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, die vom LULUCF-Sektor von 2027 bis 2030 gebunden werden. Derartige Annahmen halten viele Fachleute für Augenwischerei. Sie dienten nur als Rechtfertigung, beim Klimaschutz nicht allzu forsch vorgehen zu müssen.
Mit der klimapolitischen Legende der Landnutzung räumt der Beirat nun offiziell und gründlich auf. Seit 2014 sei der LULUCF-Sektor in Deutschland zu einer Netto-Emissionsquelle geworden, stellen die 16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler klar. Dadurch gerate die deutsche Klimaneutralität heftig ins Wanken. Statt – wie im Klimagesetz festgeschrieben – im Jahr 2045 etwa 40 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent einzubinden, wird der Sektor nach derzeitiger Prognose knapp 35 Millionen Tonnen emittieren. Die Landnutzungsziele des Klimagesetzes noch zu erfüllen, hält der Beirat für eine »enorme Herausforderung«.
Das größte CO2-Potenzial weisen die WBNK-Mitglieder der verstärkten Wiedervernässung von Mooren zu. Trockene Moore in Niedersachsen stoßen allein mehr Klimagase aus als ganz Slowenien, solche in Bayern mehr als ganz Island und die in Mecklenburg-Vorpommern mehr als Jamaika, rechnet der Beirat vor. Die Vernässung könne ein Moor hingegen wieder zur CO2-Senke machen – auch wenn es etwa 15 Jahre dauert, in etwa die Leistung eines niemals entwässerten zu erreichen.
In den vergangenen Jahrzehnten wurden in Deutschland im Schnitt jährlich um die 2000 Hektar Moore wiedervernässt. Für das Ziel der Klimaneutralität 2045 greift der WBNK die bereits seit Jahren bestehende Forderung auf, jedes Jahr mehr als 50 000 Hektar zu vernässen. Um dem Nachdruck zu verleihen, schlägt der Beirat vor, ein eigenes Flächenziel ins Klimagesetz aufzunehmen. Bis 2045 sollten etwa 80 Prozent der heutzutage landwirtschaftlich genutzten Moorflächen vernässt werden.
Das Gremium vergleicht diese Moor-Renaissance vom gesellschaftlichen Stellenwert her mit dem Kohleausstieg. Es hält die Bereitstellung von zunächst etwa einer Milliarde Euro pro Jahr für die Rückumwandlung für angemessen. Bis 2045 käme eine nicht geringe Summe zusammen, aber deutlich weniger als für den Kohleausstieg, den sich Deutschland um die 40 Milliarden Euro kosten lässt – ohne damit eine natürliche CO2-Senke zu erzeugen.
Moor-Klimaschutz ist aber nicht nur eine Frage des Geldes, macht der WBNK deutlich, sondern vor allem einer anderen Agrarpolitik. So verlangt der Beirat, die Subventionierung der Landwirtschaft auf entwässerten Moorböden dort einzustellen, wo Wiedervernässungsoptionen existieren. Schon eine solche Forderung ist ein rotes Tuch für die Lobby konventioneller Agrarwirtschaft. Der Beirat geht aber noch weiter und will Moorklimaschutz als »überragendes öffentliches Interesse« gesetzlich verankert sehen und aus dem Erneuerbare-Energien-Recht die Idee der »Beschleunigungsgebiete« auf die Planung von Wiedervernässungsprojekten übertragen.
Zu solchen Fragen des natürlichen Klimaschutzes hätte man den Bundesumweltminister und seinen Beirat gern direkt befragt. Aber ein presseöffentliches Treffen habe aus Termingründen nicht stattfinden können, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Die Vorschläge des WBNK werde das Ministerium aber sorgfältig prüfen und dann in die Weiterentwicklung des »Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz« einfließen lassen.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.