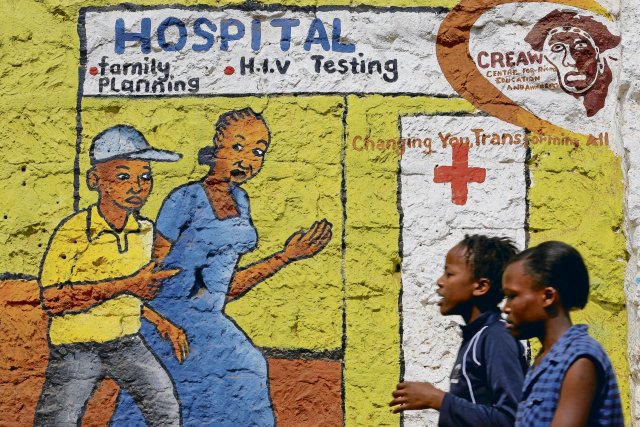- Wirtschaft und Umwelt
- Südasien
Wachstum allein reicht nicht
Ermutigende Einschätzung der Weltbank für Sri Lanka, aber viele Herausforderungen für den linken Präsidenten bleiben

Es ist eine Zahl, um die viele europäische Länder Sri Lanka beneiden dürften. Um 4,6 Prozent wird die Wirtschaft des südasiatischen Inselstaates dieses Jahr zulegen. Die aktuelle Wachstumsprognose auf Grundlage der ersten neun Monate steht in einem Bericht, den der Regionalleiter der Weltbank für Sri Lanka, Nepal und die Malediven, David Sislen, kürzlich vorgelegt hat.
Noch vor zwei Jahren schien ein solch robuster Aufschwung undenkbar. Damals waren die Devisenreserven nahezu aufgebraucht, die Inflation galoppierte und die Regierung war temporär nicht in der Lage, ihre internationalen Gläubiger beim Schuldendienst zu bezahlen. Auf dem Höhepunkt dieser schlimmsten Zustände seit der Unabhängigkeit 1948 machte sich auch noch eine akute Versorgungsnotlage breit, da auch das Geld für Importe arg begrenzt war. Bilder langer Schlangen vor den wenigen noch funktionierenden Tankstellen gingen um den Globus. Ebenso von den Massenprotesten, die im Juli 2023 Präsident Gotabaya Rajapaksa zu Rücktritt und zeitweiser Flucht ins Ausland zwangen.
Vor einem Jahr löste dann der Marxist Anura Kumara Dissanayake nach einem Erdrutsch-Wahlsieg den neoliberalen Interims-Staatschef Ranil Wickremesinghe ab. Als Hoffnungsträger vieler ist Dissanayake angetreten, nicht nur den Stabilisierungskurs fortzusetzen, sondern auch soziale Härten abzufedern und echten Wandel zu bringen. Der Weltbank-Report als eine Art externer Zwischenbilanz illustriert dabei Ermutigung, macht aber zugleich die andauernden Herausforderungen deutlich. Noch immer steht die stolze Inselnation am Anfang eines langen Prozesses. Dass das Wachstum laut der Prognose schon 2026 vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten auf 3,5 Prozent zurückgehen mag, ist nur eine Facette. Beim alternativen Kurs zu bleiben, der nicht primär dem Druck ausländischer Geldgeber folgt, ist für den Präsidenten, den viele Landsleute liebevoll nur nach seinem Vornamen Anura nennen, nicht einfach.
Seit einem Monat befinden sich beim staatlichen Energieversorger die Mitglieder von 25 Einzelgewerkschaften in einer Art Bummelstreik.
-
Beim Aufbau einer »fairen Wirtschaft, von der alle Haushalte profitieren«, brauche Sri Lanka Investitionen des privaten Sektors, um neue Jobs zu schaffen, und müsse zusehen, dass »jede Rupie an öffentlichen Mitteln gut ausgegeben wird«, heißt es im Weltbank-Report. Selbst die linker Gedankengänge unverdächtige Bretton-Woods-Organisation sieht also allein in robustem Wachstum nicht die Lösung. Sislen verwies darauf, dass die ökonomische Leistungsfähigkeit noch unter der von 2018 liege und die Armut, obgleich sinkend, noch doppelt so hoch wie im Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie sei. Mangelernährung bleibe ein Thema, beim Arbeitsmarkt sei der Aufschwung erst ungenügend angekommen, und auch das Zehntel der Bevölkerung, das nur minimal über der offiziellen Armutsgrenze lebe, habe sehr zu kämpfen.
Neben der Schwerfälligkeit des Beamtenapparats macht auch der Widerstand gegen Reformpläne zu schaffen. Anura ist bemüht, die vom Internationalen Währungsfonds, an dessen Tropf Sri Lanka hängt, angestrebten Privatisierungen nicht komplett umzusetzen. Aber selbst die geplante Neustrukturierung des staatlichen Energieversorgers Ceylon Electricity Board, der mit klarer Aufgabentrennung in sechs neue, aber in öffentlicher Hand verbleibende Einzelbetriebe aufgespalten werden soll, löst Protest aus. Seit einem Monat befinden sich dort die Mitglieder von 25 Einzelgewerkschaften in einer Art Bummelstreik. Sie machen strikt »Dienst nach Vorschrift«, verweigern jede zusätzliche Leistung. Die meisten der beteiligten Gewerkschaften, die vor allem Ingenieure und Techniker vertreten, stehen den rechtssozialdemokratischen bis konservativen Oppositionsparteien nahe.
Das hat vor allem zur Folge, dass die wetterbedingt verstärkt auftretenden Stromausfälle derzeit nur im Schneckentempo behoben werden. Viele Menschen müssen somit länger im Dunkeln sitzen oder können wichtige elektrische Gerätschaften nicht nutzen, da eine Reparatur, die sonst binnen Stunden erledigt ist, sich nun Tage hinziehen kann. Eigentlich könne man in 48 Stunden rund 60 000 Störungen abbauen, so ein Gewerkschafter vor Reportern. Jetzt dauert alles eine gefühlte Ewigkeit. In einer Verschärfung der Maßnahmen hat das Bündnis nun verkündet, auch die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium einzustellen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.