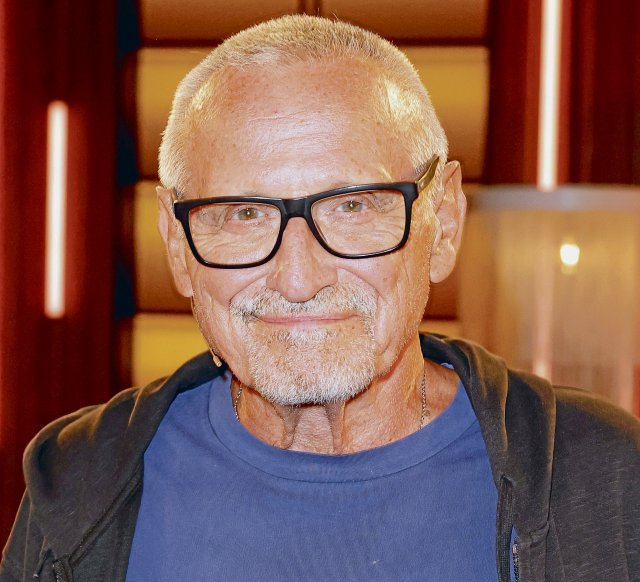- Kultur
- Ernst Thälmann
Hoffen auf Stalin
Warum es nicht gelang, Ernst Thälmann aus den Klauen der Faschisten zu befreien

In der Nacht vom 17. zum 18. August 1944 wurde Ernst Thälmann im KZ Buchenwald ermordet. Die ruchlose Tat ist drei Tage vorher beschlossen worden, am 14. August, auf einer Unterredung zwischen Himmler und Hitler in der »Wolfsschanze«. Auf seinem Notizblatt hatte der »Reichsführer SS« und Reichsinnenminister zwölf Punkte notiert, die das Schicksal prominenter Gegner und Kritiker des Regimes besiegelten. Auf der Liste standen die Namen des vormaligen deutschen Botschafters in der Sowjetunion, Werner Graf von der Schulenburg, der Marschälle Günther von Kluge und Erwin Rommel und des früheren Reichskanzlers Joseph Wirth sowie unter Punkt 12 Thälmann: »Ist zu exekutieren«.
*
Im Archiv des Präsidenten der Russischen Föderation befinden sich insgesamt 24 Briefe und andere Schriftstücke Thälmanns, die Rosa Thälmann zwischen November 1939 und April 1941 bei elf Besuchen in der sowjetischen Botschaft in Berlin zur Weiterleitung nach Moskau übergeben hatte. Diese Schreiben waren in letzter Instanz für Stalin und seinen Adlatus Molotow bestimmt, auch wenn in der Mehrzahl der Fälle kein Adressat genannt wurde. Doch Stalin interessierte sich nicht für die Probleme, die ihm Thälmann, sein bedingungslos treuer Gefolgsmann, so dringend nahebringen wollte. Er ordnete an, die Schreiben Thälmanns als »Streng geheim« ins Archiv zu geben und sie nur Mitgliedern des Politbüros zugänglich zu machen.
Mehr als ein halbes Jahrhundert blieben Thälmanns Texte unter Verschluss. Erst die unter der Losung von »Glasnost« und »Perestroika« in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eingeleiteten Veränderungen in der Sowjetunion eröffneten die Möglichkeit, sie wieder aus dem Archiv zu holen und damit dem Vergessen zu entreißen. 1996 wurden die Texte erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht. Im selben Jahr erschienen die vierundzwanzig Schreiben Thälmanns in der Zeitschrift »Novaja i novejšaja istorija« in russischer Sprache.
Ebenso bemerkenswert wie Thälmanns Texte selbst waren und sind die Umstände, unter denen sie nach Moskau gelangten. Da seit Anfang 1939 der Kontakt zur Auslandsleitung der KPD abgerissen war und es über Monate hinweg keinen erkennbaren Versuch gegeben hatte, diesen Kontakt wiederherzustellen, sah Rosa Thälmann keinen anderen Ausweg, als die sowjetische Botschaft in Berlin aufzusuchen, um so wieder Verbindung zu ihren Genossen zu erhalten. Am 8. November 1939 berichtete Alexander Schkwarzew, der sowjetische Botschafter in Berlin, dass in der Botschaft eine Frau vorgesprochen habe, die sich als Ehefrau von Ernst Thälmann vorgestellt habe. In dem Telegramm nach Moskau hieß es weiter: »Die Frau übermittelte die Bitte ihres Mannes, herauszufinden, ob Moskau sich noch um ihn kümmere. Sie wolle persönliche Briefe von Thälmann aus dem Gefängnis übergeben, um Moskau an Thälmann zu erinnern.«
Wie wohl jeder Gefangene in einer vergleichbaren Situation machte sich auch Ernst Thälmann immer wieder Gedanken darüber, wann und wie er seine Freiheit wiedererlangen könnte. Kurz nach seiner Verhaftung hatte er seiner Frau geschrieben, dass er sich auf eine längere Haftzeit eingestellt habe. Man müsse »eben durchhalten«. Sein ganzes bisheriges Leben sei stürmisch gewesen, und so werde es wohl auch bis zu seinem Tod bleiben.
Von Anfang an drängte Thälmann, verhaftet am 5. März 1933, auf eine beschleunigte Durchführung seines Prozesses: Er wollte sich über das Gerichtsverfahren Klarheit über seine Lage verschaffen. Dabei hielt er einen von ihm selbst erkämpften Freispruch wie im Fall von Georgi Dimitroff im Reichstagsbrandprozess im September 1933 ebenso für möglich wie eine kurze Haftstrafe. In einem umfangreichen Brief von Ende September 1934, der durch einen Wachmann aus dem Gefängnis geschafft worden war, hatte Thälmann davon gesprochen, dass er mit einer Haftstrafe von höchstens drei Jahren, »vielleicht sogar nur Gefängnis« statt Zuchthaus, rechnen würde. Sein Kommentar: »Sitze ich auf einer Arschbacke ab.« Dann wieder fabulierte er über eine Flucht auf eigene Faust: »Hier wäre es des Nachts nach meiner Meinung auch denkbar, zu entkommen. Natürlich, derjenige [Wachmann], der [meine Zelle] öffnet, muss sofort auf Nimmerwiedersehen mit verschwinden. [...] Über Hof und Mauer ist das, wenn es drinnen glückt, absolut denkbar. Aber dazu gehören Nerven und auch Menschen. Ich habe sie, ob sie andere haben, weiss ich nicht. Also hoffnungsloser Fall! Vielleicht später. Ich bin noch jung und frisch und möchte meine grossen Lehren und Erfahrungen, die ich hier gesammelt und aufgespeichert habe, noch einmal für das Grosse, das Gewaltige, den unbeirrbaren Glauben für die werktätige Menschheit nützlich verwerten.«
Bereits am 28. März 1933, also etwa drei Wochen nach der Verhaftung Thälmanns, war Hans Kippenberger durch die Parteiführung beauftragt worden, einen Mitarbeiter seines Militärpolitischen Apparates zu benennen, der sich »ausschließlich um die Angelegenheiten Thälmanns zu kümmern hat«. Zunächst ging es nur darum, eine stabile Verbindung zu Thälmann und dessen Frau aufzubauen, durch die mündliche und schriftliche Informationen ausgetauscht werden konnten. Doch der Aufgabenbereich erweiterte sich sehr schnell. Noch während Thälmann im Gefängnis im Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz saß, wurden durch Kippenbergers Mitarbeiter Möglichkeiten einer Befreiungsaktion geprüft.
Zu konkreten Planungen für eine Flucht Thälmanns kam es ab Mitte 1934. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Thälmann bereits seit mehr als einem Jahr im Untersuchungsgefängnis in Moabit. Franz Schubert, dem Leiter der zentralen Abwehrstelle der KPD in Prag, war es gelungen, über einen Mittelsmann Kontakt zu einem der Gefängniswärter herzustellen, die in der Umgebung von Thälmann eingesetzt waren: Emil Moritz, ein früherer Sozialdemokrat, erklärte sich bereit, bei der Befreiung Thälmanns im doppelten Wortsinn eine Schlüsselrolle zu spielen. Er sollte mit eigens gefertigten Nachschlüsseln Thälmanns Zellentür und alle weiteren Türen auf dem Weg aus dem Gefängnis öffnen. Der Fluchtplan war über Wochen und Monate hinweg detailliert ausgearbeitet und vorbereitet worden. Schubert selbst hatte alle Stationen der Fluchtroute auf Schwachstellen geprüft. Anfang Januar 1935 waren alle Vorbereitungen abgeschlossen. Doch aus Moskau kam trotz wiederholter Nachfragen zunächst keine Antwort. Erst Anfang März 1935 wurde die Durchführung des Planes mit scharfen Worten untersagt. Die Begründung, dass die Sicherheit der gesamten Aktion nicht gewährleistet sei, weil der Personenkreis, der von den Fluchtplänen wusste, zu groß war, konnte nicht wirklich überzeugen.
Gegen die Annahme, dass eine Befreiung Thälmanns zu diesem Zeitpunkt, also Anfang 1935, grundsätzlich nicht mehr gewollt war, spricht zumindest die Tatsache, dass es vermutlich 1937 einen weiteren ernsthaften Versuch gab, Thälmann aus der Untersuchungshaftanstalt in Moabit zu befreien. Allerdings ist nicht bekannt, von wem die Initiative zu diesem zweiten Befreiungsversuch ausging. Daher ist es auch vorstellbar, dass es sich um eine »private« Aktion handelte, die ohne Wissen der Führung der KPD beziehungsweise der Moskauer Gremien vorbereitet wurde. Sehr wahrscheinlich scheiterte dieses zweite Unternehmen an einem Missgeschick des Gefängniswärters Emil Moritz, der erneut bereit gewesen war, an der Befreiung Thälmanns mitzuwirken: Moritz hatte das Türschloss von Thälmanns Zelle geölt, um die unvermeidlichen Schließgeräusche beim heimlichen Öffnen der Tür während der Nacht zu verringern. Doch Moritz hatte dabei ein paar Ölflecken hinterlassen, die andere Angehörige des Wachpersonals stutzig machten. Zunächst wurde Moritz innerhalb der Haftanstalt versetzt, dann aber im Juni 1937 verhaftet und im Oktober 1937 zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Am Tag nach der Urteilsverkündung soll er Selbstmord begangen haben ...
Nach mehr als zweieinhalb Jahren in Einzelhaft, in denen er entschlossen war, gegenüber Freund und Feind seine unerschütterliche Standhaftigkeit unter Beweis zu stellen, gab es auch bei Thälmann Momente, in denen sich Hoffnungslosigkeit und sogar Verzweiflung den Weg brachen. An seine Genossen richtete er deshalb die Frage: »Warum seid Ihr solche Scheisskerle und lasst mich hier im Stich. Schon einzelne kühne Männer können es erreichen, was man das Wunder des 20. Jahrhunderts nennen würde. Seit wann sind wir Pazifisten geworden und fürchten die Mauern und Höfe der barbarischen Staatsgewalt?« Doch dann besann sich Thälmann umgehend: »Wenn höhere Gewalt das verlangt auszuhalten, gut, ich füge mich, wenn auch gezwungen und ungern!«
In seinen in den frühen 1960er Jahren niedergeschriebenen Erinnerungen berichtete der damals im Schweizer Exil unter Decknamen lebende Walter Trautzsch, dass Thälmann Anfang Januar 1937 den Gedanken äußerte, die sowjetische Regierung könnte über einen Austausch seine Freilassung erreichen. Er habe, so der weitere Bericht des sogenannten Thälmann-Kuriers, diese Idee nach Paris übermittelt. Nach einigen Wochen sei ihm mitgeteilt worden, »daß die Sowjetunion den Vorschlag Thälmanns für ungeeignet, resp[ektive] für nicht gangbar halte«. Eineinhalb Jahre später, im August 1938, informierte Trautzsch in einem Bericht, dass Thälmann bei einem Besuch seiner Frau die Frage eines Austausches erneut angesprochen hatte. Und nicht nur das. Thälmann hatte genaue Vorstellungen entwickelt, wie sich ein Austausch arrangieren ließe. Thälmann verwies auf die angespannte Wirtschaftslage in Deutschland, die Chancen für eine wirtschaftliche Annäherung an die Sowjetunion bieten würde. Die Sowjetunion könne die Lage nutzen, »um auf dem Wege neuer Wirtschaftsverhandlungen […] Konzessionen verschiedener Art zu erreichen«. In diesem Zusammenhang fragte er nach der Möglichkeit, »seine Freilassung auf dem Verhandlungswege durch Fühlungnahme mit den leitenden Handelspartnern zu stellen und so oder so zu erreichen?« Doch auch diese Frage blieb ohne Antwort. Das lag keineswegs daran, dass wenige Wochen später der Kurier »Edwin« verhaftet wurde und der Kontakt zu Thälmann abriss.
Die Entscheidung darüber, ob die sowjetische Regierung Schritte zur Befreiung Thälmanns unternehmen würde, sich also auf Verhandlungen über einen Austausch einließ, lag ausschließlich bei Stalin. Und Stalin, in dessen politischem Kalkül Menschenleben niemals eine Rolle spielten, zeigte zu keinem Zeitpunkt Interesse daran, Thälmann zu helfen. Weder wollte er daran erinnert werden, dass die Politik, die Thälmann an der Spitze der KPD auf Geheiß aus Moskau in den Jahren vor dem verhängnisvollen 30. Januar 1933 vertreten hatte, in jeder Hinsicht gescheitert war, noch wollte er dulden, dass neben Dimitroff, dem »Löwen von Leipzig«, ein weiterer kommunistischer Spitzenfunktionär Licht auf sich zog, das einzig und allein für Stalin selbst bestimmt war.
Doch Thälmann war weder bereit noch in der Lage, den Gedanken zuzulassen, dass sich Stalin nicht für seine Freilassung einsetzen könnte. Die deutsch-sowjetische Annäherung, die ihren Höhepunkt mit dem Nichtangriffsvertrag vom 23. August 1939 und dem Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 erlebte, war für Thälmann in mehrfacher Hinsicht von größter Bedeutung. Wie ungezählte Kommunisten in aller Welt war auch Thälmann von dem jähen Schwenk in der sowjetischen Außenpolitik überrascht und verwirrt. Doch er gestattete sich nicht, diese Überraschung und Verwirrung auch zu artikulieren. Thälmann war sich sicher, dass das deutsch-sowjetische Vertragswerk seine baldige Freilassung ermöglichen würde. Bereits am 1. September 1939 schrieb er voller Euphorie: »Die Stunde meiner Befreiung ist jetzt hoffentlich auch bald gekommen. Ich bin fest davon überzeugt, daß bei den Verhandlungen in Moskau zwischen Stalin und Molotow einerseits und Ribbentrop und Graf von der Schulenburg andererseits der Fall Thälmann zur Sprache gebracht wurde. Inwieweit er so erledigt wurde, daß ich mit meiner baldigen Freilassung zu rechnen habe, kann ich nicht wissen, aber meine Hoffnung ist heute zuversichtlicher denn je.«
Acht Wochen später, am 24. Oktober 1939, wandte sich Thälmann erneut mit einem Brief an Moskau, den seine Frau aus dem Gefängnis schmuggelte. Noch einmal betonte er, dass er »felsenfest überzeugt« sei, dass »Stalin und Molotow die Frage der Freilassung der politischen Gefangenen einschließlich die von Thälmann irgendwo und irgendwie gestellt und aufgeworfen haben«. Doch im Jahre 1939 war es nicht der Kriegszustand, der Thälmanns Freilassung verhinderte. Weder Stalin noch Hitler hatten Interesse am Schicksal Thälmanns. Vielmehr mussten sie dafür Sorge tragen, dass der widernatürliche Pakt, den ihre Außenminister unter sehr konkreten und nicht wiederholbaren Bedingungen ausgehandelt und unterzeichnet hatten, nicht durch »Belanglosigkeiten« wie das individuelle Schicksal Thälmanns belastet oder gar gefährdet wurde. Keiner Seite konnte daran gelegen sein, durch eine »Probe aufs Exempel« die Festigkeit des Paktes vorzeitig zu testen. Insofern war und ist es historisch falsch, zu unterstellen, dass das sprichwörtliche »Fingerschnippen« von Stalin genügt hätte, um Thälmann freizubekommen.
Bis zum Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 waren Stalin und sein Adlatus Molotow verzweifelt bemüht, alles zu unterlassen, was Hitler als »Provokation« hätte auffassen können. Nicht zuletzt deshalb hatte Molotow Kominternchef Dimitroff Ende März 1941 mit einer entsprechenden »Empfehlung« gezwungen, auf eine Kampagne zum 55. Geburtstag Thälmanns zu verzichten. Spätestens mit dem Beginn des deutschen Krieges gegen die Sowjetunion musste Thälmann begreifen, dass es keine realistische Chance auf eine Freilassung mehr gab. Für Thälmanns menschliche Größe spricht, dass er auch in dieser hoffnungslosen Lage nicht bereit war, die von seinen Peinigern immer wieder geforderte Erklärung abzugeben, mit der er sein Scheitern als Kommunist eingestand, um sich so den Weg in die Freiheit zu erkaufen.
Auszug aus der neuen Thälmann-Biografie von Ronald Friedmann: »Wenn Moskau es so will ...« (Trafo Wissenschaftsverlag, 522 S., geb., 44,80 €).
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.