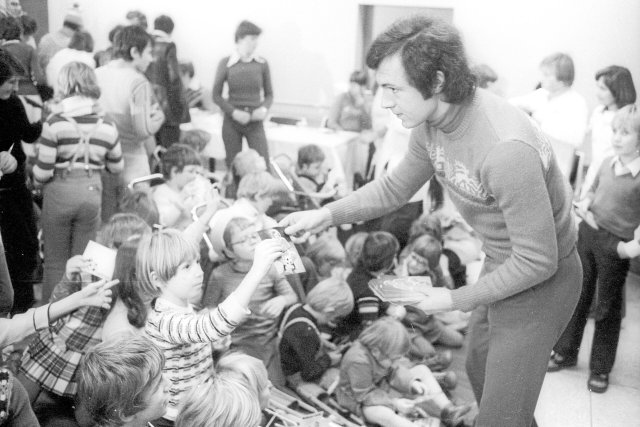- Kultur
- Henk Broekhuis
Karel van het Reve räumt mit sprachlichen Absurditäten auf
Eine noch immer aktuelle Warnung vor Binsen und Behauptungen vom Niederländer Karel van het Reve

Künstler bringen in ihrer Arbeit ihre Gefühle zum Ausdruck. Stimmen Sie dem zu? Vorsicht: Es könnte sich dabei um einen Gemeinplatz handeln. Oder das hier: Lesen bildet. Oder doch nicht? Kommt darauf an, was man liest? Ja, wir bewegen uns im Sumpf der Trivialität, im Niemandsland erkenntnisfreier Aussagen. Wie diese hier: Im Sommer haben wir ein nettes kleines Hotel im Elsass gefunden? Das ist ein rhetorischer Automatismus, da »keiner jemals sagt, er sei in einem großen Hotel gewesen, und die Botschaft dadurch etwas Allgemeines gewinnt, an eine Mitteilung erinnert, die man oft gehört hat und gern wiederholt«, analysierte Karel van het Reve (1921–1999).
Er war ein niederländischer Schriftsteller wie sein bekannterer jüngerer Bruder Gerard Reve (1923–2006). Unter dem Pseudonym Henk Broekhuis räumte Karel in Essays für die Zeitung »NRC Handelsblad« mit weitverbreiteten Binsen und Behauptungen auf, wie denen, dass die Werbung uns zwinge, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen; Schriftsteller die Sprache bereicherten oder Vergleiche der Verdeutlichung dienten. 50 Jahre nach ihrem Erscheinen liegen die 39 schönsten endlich auf Deutsch vor und bereiten erhebliches Vergnügen.
Reve verstand diese Essays als Fortsetzung des »Dictionnaire des idées reçues« von Gustave Flaubert (1821–1880), in dem dieser um 1870 versucht, allgemein akzeptierte Ideen und Auffassungen zu sammeln und unschädlich zu machen. Über diese schüttet Reve Hohn und Spott aus.
Besonders angetan hatten es ihm Wichtigtuer im akademischen Habit. Er kann es nicht leiden, wenn jemand fordert: »Das Verhalten einer Romanfigur muss psychologisch fundiert sein.« Nachdem er die These anhand prominenter Beispiele aus der Literaturgeschichte lustvoll zerpflückt, lautet sein Verdikt: »Über ein Buch, das man als Leser nur mit größter Mühe bis zur letzten Seite schafft, lässt sich immer noch sagen, es sei psychologisch fundiert.« Auch der Begriff »kreativ« macht ihm zu schaffen. Für ihn gibt es »keine niederländische Prosa, die die Mühe wert ist, gelesen zu werden, in der das Wort ›kreativ‹ auftaucht.« Im luziden Nachwort erkennt Arnon Grünberg in Reves Verbissenheit seine größte Schwäche. »Ernst war für ihn auch Wichtigtuerei, doch wenn man versucht, eine solche Haltung konsequent durchzuhalten, wird die Anti-Wichtigtuerei selbst ebenfalls zur Wichtigtuerei.«
Aber dass ein Künstler in seinem Werk seine Gefühle zum Ausdruck bringt – läßt er wenigstens das gelten? Sie ahnen es schon: »Ich könnte Ihnen genau sagen, mit welchen Gefühlen ich mich trage, während ich diese Zeilen schreibe. Eine banalere Ansammlung von Empfindungen ist kaum denkbar …« Um gleich danach Mozart zu bemühen, der niemals die »Sonate facile« geschrieben hätte, hätte er sich mit seinen Gefühlen beschäftigt. »Und glauben Sie, dass ER, der das Wattenmeer erschuf, dabei auch nur einen Augenblick lang an so etwas Überflüssiges wie seine eigenen Gefühle gedacht hat?« Reve, Mozart, Gott – verbunden in emotionaler Ignoranz: eine verwegene niederländische Klimax und ein echter Broekhuis.
Karel van het Reve: Stunden mit Henk Broekhuis. Gemeinplätze und was von ihnen zu halten ist. A.d. Niederl. v. Gerd Busse. Elsinor Verlag, 204 S., geb., 20 €.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.