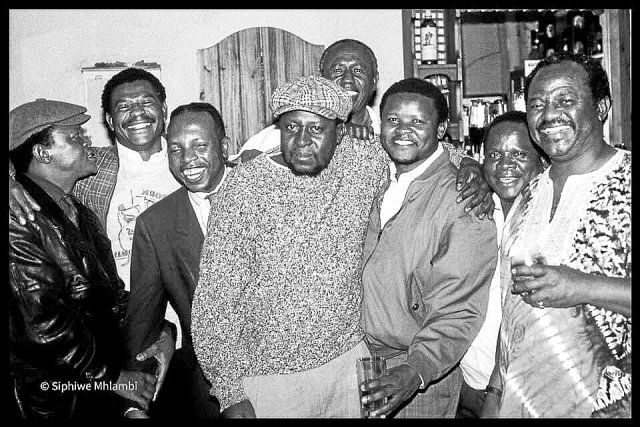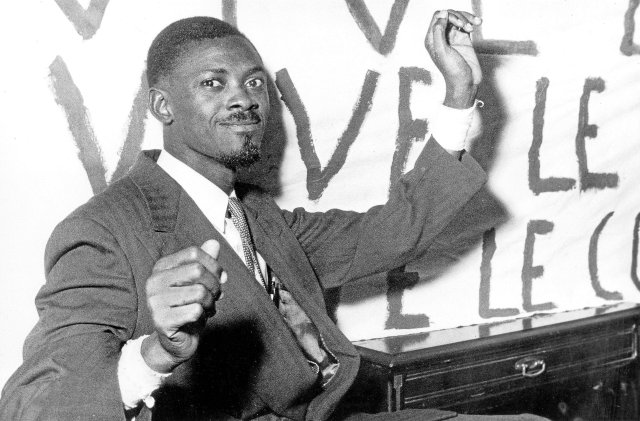- Kultur
- Band
Computerspiele: Das unbegreifliche Medium
Ein neuer Band stellt nun 50 bedeutende Computerspiele vor – und nähert sich so einer Bestimmung des Mediums an

Als sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts das Kino als Massenmedium popularisierte, wurde aus bloßer Publikumsattraktion schnell ein integraler Bestandteil einer Kultur der Modernität. Intellektuelle reflektierten das neue Medium und seine Potenziale, in der Kunst versprach man sich avantgardistischen Ausdruck. Computerspiele mussten oft den Vergleich zum Film aushalten. Handelt es sich nicht ebenfalls um ein Medium, das den Umbruch einer ganzen Kulturepoche, dieses Mal zur Digitalität, symbolisiert?
Gemessen daran stehen wir heute mit den Computerspielen allerdings immer noch auf einer frühen Reflexionsstufe. Seit über 40 Jahren gibt es die digitalen Spiele, mittlerweile spielt wortwörtlich die halbe Welt und schon lange wirft der Markt entsprechend hohe Umsätze ab, mit Spieletiteln, deren Produktionsbudget an manche Hollywood-Produktionen heranreicht. Und doch bleibt die Auseinandersetzung mit dem Medium verhalten. Das liegt nicht nur am Nimbus des Spiels, das sich für Wissenschaft und Hochkultur zu sehr nach Kinderkram anhört. Es rührt auch von einer Schwierigkeit des Mediums selbst her: Es gibt Spiele, die epische Geschichten erzählen, cineastisch anmuten und Charaktere erschaffen, die in den Fantasien der Rezipierenden eigenständig weiterleben. Aber niemand würde auf die Idee kommen, das Blöcke-Stapeln von »Tetris« oder das Handyspiel »Candy Crush« als große Erzählung zu verbuchen. Im Spannungsfeld zwischen narrativem Medium und bloßer Wiederholung festgelegter Regelwerke befinden sich Computerspiele immer noch in der Selbstfindung. Entsprechend schwer ist es, überhaupt eine Sprache und einen Ausdruck für diese diversen Phänomene zu finden, die kulturell so unterbelichtet bleiben und doch aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind.
Dieses Problems nimmt sich nun der Band »Computerspiele. 50 zentrale Titel« an, herausgegeben von dem Philosophen Daniel Martin Feige und dem Spieleforscher Rudolf Inderst. Um sich dem Kern des diffusen Mediums anzunähern, gehen sie von den einzelnen Phänomenen aus und versammeln Beiträge verschiedenster Autor*innen aus Wissenschaft und Spielekultur zu der Frage, was eigentlich bedeutende Computerspiele sind.
Unüberschaubare Bandbreite
Allein die Auswahl der als wichtig erachteten Spiele ist bereits ein Ringen mit dem Medium. Denn trotz der gewählten Breite bieten die Herausgeber keinen Kanon dar: Wichtige Spiele fehlen, andere Entscheidungen der Auswahl verwundern regelrecht. Aber gerade in der Grenzbestimmung lässt sich die Reflexion darüber anstoßen, was überhaupt als wichtige Repräsentation des Mediums gilt – was es schließlich also ausmacht.
Naheliegend ist, wie die Herausgeber zu Beginn des Bandes in einem kurzen Gespräch diskutieren, dass im Band eine zeitliche Spannbreite der Spieleentwicklung abgedeckt werden soll. Titel wie das erste kommerzielle Computerspiel »Pong« aus dem Jahre 1972, bei dem in höchster Abstraktion Tennis gespielt wurde, stehen daher neben zeitgenössischen Titeln wie »Baldur’s Gate«, das zuerst 1998 das klassische Rollenspiel enorm popularisierte und dessen dritter Teil 2023 mit seiner Spieltiefe für Aufsehen sorgte. Schon allein daran wird klar, mit welcher Vielfalt von Spielvarianten, aber auch Unterschieden in Komplexität oder grafischer Darstellung man es zu tun bekommt. Der Band muss daher auch den zahlreichen Genres Rechnung tragen: Von Simulationen aus Geschichte (»Die Siedler«) oder bloßem Alltag (»The Sims«) reichen die Titel über das klassische Jump-and-Run »Super Mario Bros.«, Puzzle- oder Sportspiele, Weltraumflugsimulatoren (»Wing Commander«) bis zu Abenteuerspielen unterschiedlichster Ausprägung und fantastischen Rollenspielwelten.
Aber diese bloß formalen Kriterien von Vielfalt und Epoche würden kaum erklären können, warum nun also bestimmte Spiele größere Kulturbedeutung erlangten als andere. Relevant werden Spiele in der Kulturindustrie durch ihre Massentauglichkeit, die sich vor allem in kommerziellem Erfolg und Serienmäßigkeit äußert. Aber sie werden eben auch wichtig durch ihre Besonderheiten: In seinem Beitrag zum eher unbekannten Spiel »Planescape: Torment« betont Feige etwa, es handele sich dabei um »eines der narrativ ambitioniertesten Computerrollenspiele aller Zeiten«. Durch die besondere Tiefe der Erzählung, aber eben auch durch Innovationen in Spielmechanik oder Narration werden Spiele zu »zentralen Titeln« für das Medium.
Prägung nach innen und außen
Auf dieser Bedeutungsebene zählt weniger kommerzieller Erfolg, als vielmehr die prägende Wirkung einzelner Spiele auf die Entwicklung des Mediums. Titel wie das ikonische »The Legend of Zelda« haben nicht nur eine enorm erfolgreiche Spielereihe nach sich gezogen, die bis heute läuft, sondern Maßstäbe für Abenteuer-Spiele, sogenannte Action Adventures, gelegt. Bereits 1986 etablierte der Spieleklassiker das Prinzip einer offenen, von der Spielerin selbst zu erkundenden virtuellen Welt, die in heutigen Spielen zu gigantischen Open Worlds angewachsen ist.
An anderer Stelle finden sich im Band Titel wie »Call of Duty 4: Modern Warfare«, also erst der vierte Teil der Spielereihe, »The Witcher 3«, »The Elder Scrolls V« oder »Grand Theft Auto V«, weil erst diese jeweiligen Spiele zu bestimmten Durchbrüchen geführt haben. Wie innovativ oder bahnbrechend diese Entwicklungen dann tatsächlich sind, steht auf einem anderen Blatt. Etwa wird der siebente Teil der Rennspielserie »Burnout« damit erklärt, er habe »nachfolgende Arcade-Racer zutiefst geprägt und bis heute nachhaltig verändert«. Letztlich hat aber »Burnout Paradise« nur ermöglicht, die virtuelle Umgebung zu erkunden und in ihr spektakuläre Crashs zu provozieren. Eher scheint hier doch die Massenwirkung relevant, sodass immerhin der ehemalige Präsidentschaftskandidat Barack Obama 2008 Wahlkampfwerbung auf den Werbeflächen im Spiel mieten ließ.
Ebenso ist es ein Relevanzkritierium für die Auswahl, wie die Spiele selbst einen Abdruck in der Kultur hinterließen – und andersherum, wie sie Kultur verarbeiten. Alle jungen Menschen wissen, dass Floss eine Tanzform aus dem Spiel »Fortnite« von 2017 ist. Das Spiel »Pokémon« begründete 1996 das »umsatzstärkste Medien-Franchise aller Zeiten« sowie ein »transmediales und globales Phänomen«. Die Spielereihen und Merchandise-Artikel um Pikachu und Co. sind aus der Jugendkultur kaum wegzudenken und bezeugen, so Hilako Kato im Beitrag, eine »Kapitalismus-Ohnmacht, die insbesondere die Eltern von Pokémon-verrückten Kindern verspüren«. Ebenso sorgt das Spiel »Minecraft« mit seiner spezifischen Ästhetik einer aus Blöcken bestehenden endlosen Welt seit 2009 für einen Hype, der bis zum Blockbusterkinofilm dieses Jahr reichte. Nicht nur reizt hier die Erkundung und der Aufbau einer »Welt als riesiger Baukasten«, wie Jacob Birken beschreibt, sondern seit vielen Jahren baut eine Community detailgetreue Bauwerke und ganze Städte auf den Minecraft-Servern nach.
Spiele lösten zudem gesellschaftliche Debatten aus, wie etwa im Falle von »Doom«, das als »das aus medientheoretischer Sicht wichtigste digitale Spiel bezeichnet werden« kann. Nicht zuletzt, weil es als Synonym für das ganze Genre des Ego-Shooters im Mittelpunkt von Debatten um Killerspiele stand, deren vermeintlich verrohende Wirkung für »Shootings« und Amokläufe vor allem an US-amerikanischen Schulen verantwortlich gemacht wurde. Als ab 2004 das MMO (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) »World of Warcraft« seinen Durchbruch hatte, wurde die Sorge um exzessiven Medienkonsum und Spielsucht zum wiederkehrenden Motiv öffentlicher Diskussionen.
Von der Diagnose zur Analyse
Inwiefern Spiele einen Zeitgeist verkörpern und Kulturelles verarbeiten, stellen René Bauer und Beate Suter etwa am Hack-and-Slay-Klassiker »Diablo« von 1996 heraus: Das Spiel um einen Helden, der durch eine mittelalterliche Dorfkiche bis in die Tiefe der Hölle hinabsteigen muss, zeige die Zeichen einer neuen Weltordnung der Ökonomisierung. »Hat man am Tag an Excel gearbeitet, so wechselt man am Abend zu Diablo, um dort weiterzumachen. (…) Diese radikalen Spiele mit dem Motto ›Arbeiten nett verpackt‹ sind geradezu Liberalisierung mit anderen Mitteln.« Die tatsächliche Analyse bleibt jedoch dünn, wenn diese Verbindung schon darin liegen soll, dass sich das Spielprinzip um einen zu optimierenden Charakter dreht.
Zweifelsohne liegt viel Anziehungskraft bestimmter Titel darin, dass sie spielerisch die Mechaniken von Optimierung, Wiederholung und Quantifizierung reproduzieren, die der (digitalisierten) kapitalistischen Gesellschaft und ihren Produktivitätszwängen zugrunde liegen. Man denke etwa an Mechaniken des »Farming«, bei dem im Spiel monotone Wiederholungen zum Erwerb bestimmter Währungen und Ressourcen notwendig sind, um etwa ein Level im süchtig machenden Handyspiel freizuschalten oder die nächste Stufe und bessere Ausrüstung im Fantasy-Rollenspiel zu erreichen. Tatsächlich spielen wir hier Arbeitsprozesse nach, die somit bis in die Freizeit reichen. Aber solche Zusammenhänge gilt es analytisch herauszuarbeiten, statt sie als viel zu allgemeine Randbemerkungen der Spielbeschreibung nachzuschieben.
Diese Erkenntnisvermittlung kann und soll der Band nicht leisten. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Spiele als Medium, ihre grundlegende Entwicklungstendenz und gesellschaftlich notwendige Präfiguration lassen sich in der Zusammenschau erahnen, aber noch nicht allgemein bestimmen. Diesem Umstand trägt das vielstimmige Kompendium allerdings Rechnung und lässt darin Punkte erkennen, an denen eine solche Analyse ansetzen kann. Auch wenn die Frage nicht direkt beantwortet wird, ergibt sich bei der Lektüre ein bestechender Eindruck, mit welch komplexem digitalen gesellschaftlichen Medium wir es zu tun bekommen – kurzum: eine Idee, was ein Computerspiel alles ist.
Daniel Martin Feige/Rudolf Inderst (Hg.): Computerspiele. 50 zentrale Titel. Transcript, 420 S., br., 39 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.