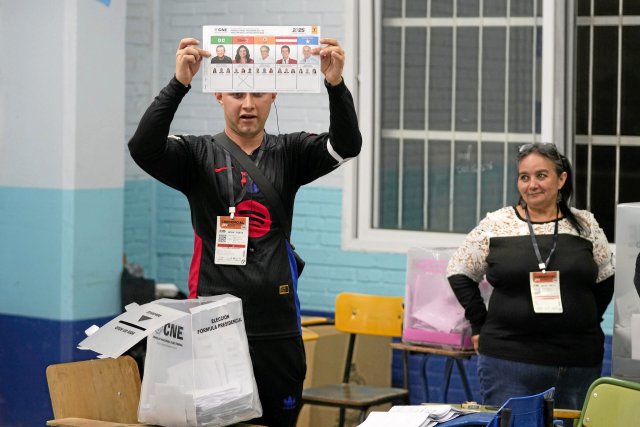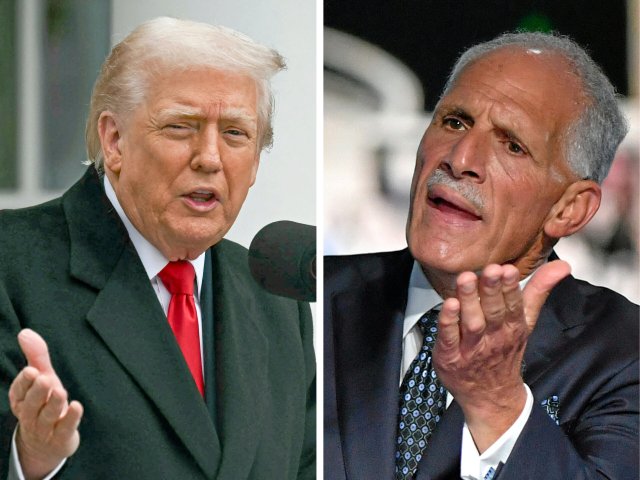- Kommentare
- Leoncavallo in Mailand
Wenn die Wut über die Räumung die Stadt ansteckt
Ilaria Salis zur Repression gegen das Soziale Zentrum Leoncavallo in Mailand

»Wenn sie einen angreifen, greifen sie alle an«, lautet die rituelle Formel, wenn die Repression zuschlägt. Aber wer sind »alle«? In der ersten Reihe stehen natürlich die Genoss*innen der Sozialen Zentren, der Kollektive, der Vereinigungen. Unabhängig von den Urteilen, die jeder über den langen Weg des Leoncavallo haben mag, ist klar, dass die Räumung des »Leo« einen harten Schlag für das gesamte Archipel der sozialen Linken darstellt. Dass die Regierungschefin Giorgia Meloni die Aktion für sich reklamiert, ebnet den Weg für eine neuartige Offensive gegen Räume der Freiheit und Unabhängigkeit.
Wie Giuliano Santoro in »Il Manifesto« treffend erklärt hat, ist der Schlag gegen soziale Wirklichkeiten für die Postfaschisten in der Regierung kein Versehen: Er ist politisches Programm – zugleich ideologische Rache und Baustein einer autoritären Agenda.
Dann gibt es noch das sogenannte weitere Umfeld: Besucher*innen, Unterstützer*innen und Sympathisant*innen, die immer die eigentliche Stärke der Sozialen Zentren ausmachten – außerordentliche urbane Anziehungspunkte für junge Menschen und Energien. Heute ist ihre Präsenz zwar spärlicher als in der Blütezeit, bleibt aber eine lebenswichtige Ressource – ein Nährboden, den es zu pflegen und zu bündeln gilt, notwendig für jedes Projekt radikaler Teilhabe.
Zu diesem »alle«, das durch die Räumung im August ins Visier geraten ist, gehört auch die politische Linke. Auch sie steht im Fokus: Eine historische Erfahrung wie das Leoncavallo zu zerschlagen, heißt zu demonstrieren, dass die Linke nicht einmal ihre eigenen Orte zu verteidigen vermag – und zugleich jene sozialen und kulturellen Reservoirs auszutrocknen, aus denen sie schöpft.
Der vielleicht interessanteste Punkt betrifft jedoch diejenigen, die in diesem »alle« bislang fehlen. Gemeint ist jene breite und vielfältige soziale Zusammensetzung, die scheinbar wenig bis gar nichts mit dem heutigen Leoncavallo zu tun hat, die sich aber – wer weiß – in dem wiedererkennen könnte, was aus dieser Geschichte hervorgeht.
Denn – und das ist der entscheidende Punkt, den auch Vertreter*innen des Sozialen Zentrums zu teilen scheinen – die Räumung betrifft nicht nur das Leoncavallo und ist auch nicht bloß eine Abrechnung zwischen der Macht und einer bestimmten politischen Gemeinschaft. Ausschlaggebend ist der Kontext, in dem diese Operation stattfindet: ein Mailand, das durch Immobilienspekulation und städtebauliche Skandale immer unbewohnbarer wird. Möglich ist auch, dass die Räumung ein Affront gegen den außen vor gelassenen Bürgermeister Guiseppe Sala war oder ein weiterer Schlag, um ein Mitte-links-Bündnis in Bedrängnis zu bringen, das die Frage nicht lösen konnte – oder nicht wollte.
Doch die Substanz bleibt: Die Beseitigung von Räumen wie dem Leoncavallo steht keineswegs im Widerspruch zum »Mailänder Modell«. Sie ist vielmehr ein vollkommen kohärenter Baustein davon. Die neoliberale Logik, von den Verwaltungen unter Sala mitgetragen, schreibt vor, Investitionen, Eigentum und private Interessen aktiv zu schützen – notfalls mit Gewalt –, auf Kosten dessen, was nicht privat ist und anderen Logiken folgt.
So oder so musste das Leoncavallo Platz machen für die Immobilienaufwertung des Viertels. Toleriert werden konnte es nur, wenn es an den Rand verdrängt war, wo die Bodenrente niedriger ist. Und hier liegt der Berührungspunkt: Das Schicksal des Leoncavallo ist dasselbe wie das vieler Einwohner*innen der Stadt, die zunehmend an die Peripherie gedrängt werden.
Gerade jene fehlen bislang in diesem »alle« – jenes »wir«, das erst entstehen muss: die Vielen, die wie das Leoncavallo die ausgrenzenden und verdrängenden Effekte des »Modell Mailand« erleiden – zwischen polizeilicher Repression und wirtschaftlicher Gewalt.
Wenn es gelingt, die Wut derjenigen, die das soziale Zentrum liebten, mit den Interessen jener zu verbinden, die heute unter den Folgen einer immer ausschließenderen Stadt leiden – wenn der Protest gegen die Räumung sich in einen Protest gegen dieses Modell verwandeln kann –, dann, ja dann könnte alles sehr interessant werden.
Nicht nur als Widerstand gegen den unerträglichen Autoritarismus eines von Meloni geprägten Polizeistaats, sondern auch gegen die materiellen Lebensbedingungen, die uns auferlegt wurden.
Das Leoncavallo galt als das bekannteste besetzte Soziale Zentrum Italiens. Es wurde 1975 in Mailand gegründet und prägte seither mit selbstverwalteten Kultur-, Bildungs- und Sozialprojekten die außerparlamentarische Linke des Landes. Seit 1994 war es in der Via Watteau angesiedelt, betrieben vom Verein Associazione mamme antifasciste del Leoncavallo. Über Jahrzehnte hinweg war das »Leo« ein Symbol für alternative Kultur und antifaschistischen Widerstand – zugleich aber Gegenstand permanenter Konflikte mit den Eigentümer*innen, einer Unternehmerfamilie, die das Gebäude seit Langem zurückfordert. Ein Gericht hatte zuletzt entschieden, dass die Regierung den Besitzern rund drei Millionen Euro Entschädigung zahlen müsse. Am 21. August 2025 wurde das Zentrum schließlich in einer Blitzaktion auf Initiative des Innenministeriums geräumt – obwohl die Maßnahme eigentlich für September angekündigt war. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begründete das Vorgehen mit dem Hinweis, es dürfe keine »rechtsfreien Räume« geben. Die Stadt Mailand erklärte, sie sei im Vorfeld nicht informiert worden.
Der Kommentar von Ilaria Salis erschien zuerst in unserem italienischen Partnermedium »Il Manifesto«. Übersetzung: Matthias Monroy
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.