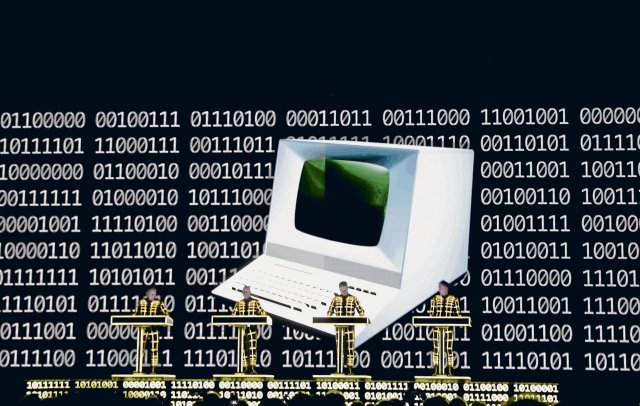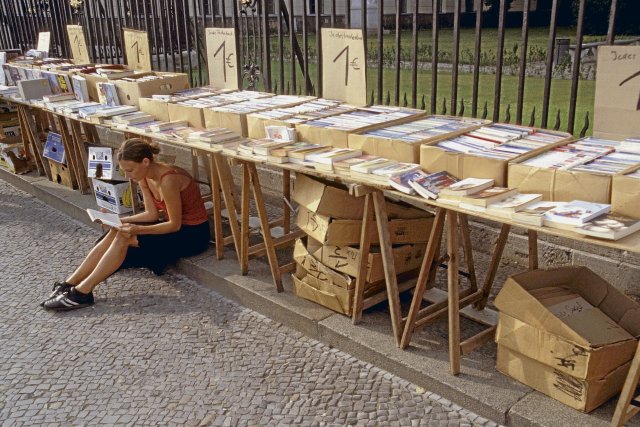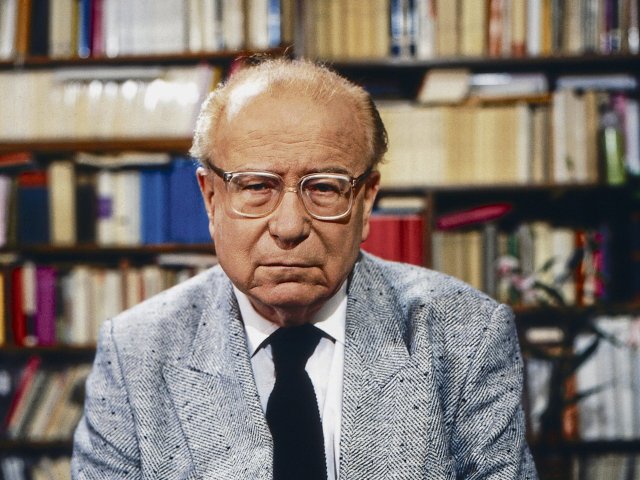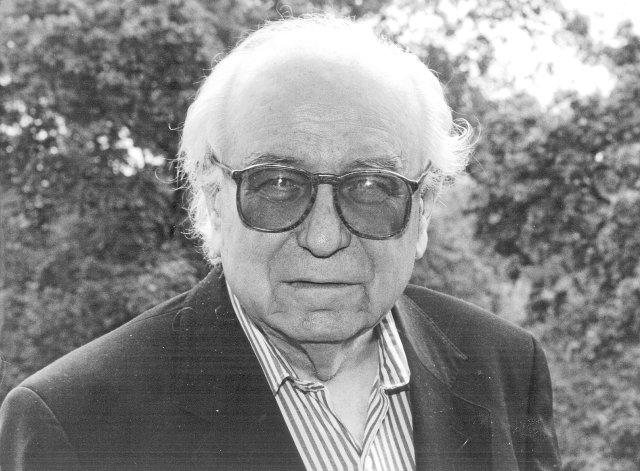- Kultur
- Film »In die Sonne schauen«
Mascha Schilinski: »Es geht darum, wie Erinnerung funktioniert«
Mascha Schilinski gewann für ihren Film »In die Sonne schauen« als erste deutsche Regisseurin den Preis der Jury in Cannes. Ein Gespräch

Frau Schilinski, Sie haben mit Ihrem zweiten Spielfilm, »In die Sonne schauen«, auf dem diesjährigen Cannes-Filmfestival einen sehr großen Erfolg gehabt. Wie war Ihre Cannes-Erfahrung?
Es war großartig. Es waren zwei tolle Wochen, die ich mit dem Team und Cast dort verbringen durfte. Es war aufregend, es gab viele Termine, aber es war vor allem einfach wunderschön, nach fünf Jahren Arbeit diesen Moment mit allen zu feiern und zu erleben, dass der Film auf dieser Weltbühne seine Premiere hatte. Das war toll.
Jetzt kennt jeder Ihren Namen in der Branche, jetzt können sich viele Türen öffnen. Aber hat solch ein Erfolg vielleicht auch etwas Herausforderndes?
Ja, also mal schauen! Es ist so lustig, denn ich bin ja immer noch die Gleiche und sitze ja immer noch am gleichen Küchentisch zu Hause. Ich spüre das gar nicht so doll. Und ich gebe die Interviews und lese sie nicht. Ich glaube, ich habe also noch gar nicht so richtig realisiert, dass das da draußen so ankommt. Es wird sich zeigen, was sich daraus ergibt. Ich hoffe natürlich, dass sich Türen öffnen. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass sich auch für andere Leute Türen öffnen. Für Künstler*innen, die versuchen, andere Wege zu gehen, oder die auch andere Filme sehen und machen wollen. Dass es hoffentlich für sie leichter wird oder dass ihnen mehr Offenheit entgegenkommt.

Mascha Schilinski wurde 1984 in West-Berlin geboren. Nach dem Fachabitur in Psychologie sowie diversen Praktika im Filmbereich arbeitete sie als Casterin für die Schauspielagentur »Gesichter« in Potsdam-Babelsberg. 2008 absolvierte sie eine Drehbuch-Masterclass an der Filmschule Hamburg, und 2012 begann sie ein Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg.
Ihr Abschlussfilm und Langfilmdebüt »Die Tochter« lief 2017 auf der Berlinale in der Sektion Perspektive Deutsches Kino. »In die Sonne schauen« ist ihr zweiter Kinofilm.
Ihr Film ist sehr originell. Er ist realistisch, aber auch metaphysisch, ist poetisch und zugleich historisch genau. Erzählt kleine individuelle Geschichten, aber auch von kollektiven Ängsten, Gefühlen und Traumata. Wie haben Sie diese Harmonie geschafft?
(lacht) Wir haben geschaut: Was würden wir selber gerne sehen, was sind es für Bilder, die da hochkommen? Und wir haben versucht, diese Bilder aufzuschreiben und assoziativ miteinander zu verbinden und zu gucken, dass sozusagen ein Bilderstrom erzeugt wird, der so ist, als würden alle Ahnen, die mal an diesem Hof gelebt haben, oder die, die da noch leben werden, gemeinsam einen Traum haben. Als würden sie sich gemeinsam erinnern. Und eine Erinnerung löst neue Assoziationen bei der anderen Figur aus, sodass wir uns eigentlich auch nie sicher sein können, ob das, was wir da sehen, echt ist oder nicht. Noch wichtiger in dem Film als das, was wir sehen, ist das, was wir nicht sehen, das, was ausgelassen wird. Wir erzählen total elliptisch und eben assoziativ, mosaikartig. Und es geht dabei darum, was wir erinnern oder wie Erinnerung funktioniert. Darum, wo wir nicht mehr an eine Erinnerung heranreichen, wo etwas verloren gegangen ist, weil da vielleicht ein Trauma passiert ist oder weil man etwas verdrängt hat.
Ihre Charaktere sind vor allem Frauen und Mädchen, die in vier unterschiedlichen Epochen – in den 1910ern, 40ern, 80ern und 2020ern – in der Altmark leben. Was hat Sie und Ihre Ko-Autorin Louise Peter zu diesen Figuren inspiriert?
Wir haben ganz lange recherchiert, wollten mehr über diesen Ort Altmark herausfinden. Es war am Anfang überhaupt nicht intendiert, dass wir einen Film aus weiblicher Sicht machen wollen. Es gab auch männliche Figuren, Jungs, alles Mögliche. Wir haben viele Figuren geschrieben, die am Ende gar nicht im Film gelandet sind. Bei der Recherche haben wir gemerkt, dass es superwenig über die Frauen von damals gibt. Es gab zwei Bücher, die aus weiblicher Perspektive geschrieben worden sind und die eigentlich ein bisschen das verlorene Paradies einer Kindheit beschrieben haben. Da wurde in so einem bullerbüartigen Ton geschildert, wie die Wäsche gefaltet wird, wie der Vater seine Pfeife stopft, wie man mit den Geschwistern im Heu tobt. Und dann gab es manchmal so kleine verstörende Halbsätze, die einfach in demselben Ton geschrieben worden sind und über die man hätte hinweggehen können, aber wir sind darüber gestolpert. Zum Beispiel: Die Magd muss erst noch so gemacht werden, dass sie für die Männer ungefährlich ist. Oder eine Magd hat gesagt: »Ich habe eigentlich ganz umsonst gelebt.« Wir haben uns gefragt: Was ist da passiert? Wir sind aber nicht weitergekommen, konnten nicht herausfinden, ob das vielleicht eine systematische Zwangssterilisation war, die da passiert ist. Wir haben dann mithilfe der Figuren fast so halluzinativ versucht, herauszufinden, was da gewesen sein könnte. Und hatten das Gefühl, dass diese Perspektiven immer so am Rande der Geschichte stattfinden und dass wir die eigentlich ganz gerne ins Zentrum holen würden.
Ihr 2023 mit dem Thomas-Strittmatter-Preis ausgezeichnetes Drehbuch hatte einen anderen Arbeitstitel. Und daraus wurde der Film »In die Sonne schauen«. Warum »In die Sonne schauen«?
Der ursprüngliche Titel, unter dem wir das geschrieben haben, war: »The Doctor Says I’ll Be Alright, But I’m Feelin Blue.« Da haben alle gesagt, Mascha, das kann keiner aussprechen, das kann man so nicht machen. Der Originaltitel des Films ist »Sound of Falling«. Mit dem Titel liefen wir auch in Cannes, das ist der internationale Titel. Wir hatten aber das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung nicht ganz stimmig ist, und der deutsche Verleih war damit nicht glücklich. Nach dem Brainstorming im Team sind wir auf »In die Sonne schauen« gekommen. Der Sonne und dem Tod kann man nur schwer ins Gesicht schauen, ohne dass es schmerzt. Doch diese Frauen im Film schauen verdammt lange hin. Außerdem gab es im Drehbuch ein Urbild – das hat so in den Film nicht reingefunden –, dass Frauen ihre Augenlider schließen und in die Sonne schauen, sodass hinter geschlossenen Lidern ein orangefarbenes Wabern, ein Pulsieren entsteht.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Erzählen Frauen andere Geschichten?
Ich glaube, dass jeder Mensch eigene Geschichten erzählt. Ich würde diese Kategorien Mann und Frau nicht aufmachen wollen. Wir sind Menschen, und ich denke, dass jeder Mensch ein Individuum ist und deswegen einen Film anders macht, als jemand anderes es machen würde.
Was war das Schwierigste beim Produzieren dieses Filmes für Sie?
Das fehlende Budget. Das ist ein Debütfilm, der auch in einem sogenannten Debüt-Rahmen entstanden ist. Und für diesen Debüt-Rahmen war unser Filmvorhaben extrem ambitioniert, mit vier Zeitebenen, zweieinhalb Stunden, vielen Kindern. Und herausfordernd war auch, dass der Film einfach fünf Jahre gedauert hat und dass man mit diesem wenigen Geld auch als Privatperson fünf Jahre überleben musste.
Wie war Ihre Erfahrung, als junge Regisseurin Filmförderung zu bekommen?
Das war natürlich essenziell. Louise (Peter) und ich haben Drehbuchförderung bekommen, ohne die wäre es nicht möglich gewesen, dass wir so frisch aus der Filmhochschule raus diesen Film hätten schreiben können. Außerdem haben wir den Thomas-Strittmatter-Preis gewonnen, der mit Geld verbunden ist. Das hat uns auch gerettet. Und dann haben wir tolle Partner finden können. Aber wir haben eben auch wichtige Förderungen nicht bekommen.
Wollten Sie immer Regisseurin werden?
Nee. (lacht) Ich weiß immer noch gar nicht, ob ich das werden will. Ich war nicht das Kind, das eine Super-8-Kamera in die Hand gedrückt bekommen hat und immer wusste, dass sie Filme machen will. Mir ist das irgendwie mehr passiert.
Sie haben in Ihren Zwanzigern andere spannende, interessante Sachen gemacht, Zauberin und Feuertänzerin inklusive.
Ich weiß nicht, was ich werden wollte. Als kleines Kind wollte ich irgendwas Tolles machen. Ich habe ganz lange überhaupt nicht gewusst, wohin. Also, wer hat das erfunden mit diesen Berufen? Irgendwas daran kommt mir bis heute so absurd vor, dass wir alle Berufe haben. Ich weiß schon, wie es dazu kam, aber ich finde es eigentlich irre, dass wir alle frühmorgens aufstehen und dann unser Leben lang einen Beruf ausüben. Ich wünschte einfach, es müsste keine Berufe geben. (lacht)
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.