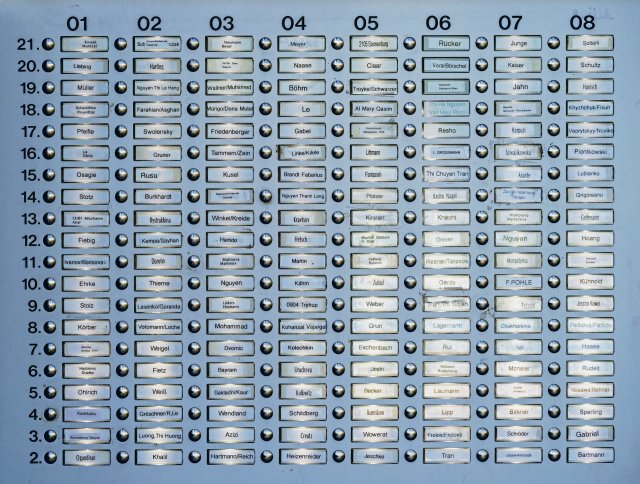- Wirtschaft und Umwelt
- New Economy
»Koloniale Ausbeutung wird digitalisiert«
Die Politökonomin Joanita Najjuko über die Auslagerung der Content-Moderation in den globalen Süden

Immer mehr Tech-Unternehmen lagern ihre Content-Moderation an KI und Subunternehmer aus. Diese sind oft in Ländern des globalen Südens tätig. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Diese Strategien spiegeln eine Abkehr von traditionellen Beschäftigungsverhältnissen hin zu prekären, ausgelagerten Arbeitsbedingungen und algorithmischer Kontrolle wider. Aus einer panafrikanisch-feministischen Perspektive ist dies keine neutrale technische oder wirtschaftliche Entscheidung. Es handelt sich um einen politischen Akt, der von neoliberalen, kapitalistischen Logiken der Ressourcenausbeutung, rassifizierten und geschlechtsspezifischen Arbeitshierarchien geprägt ist.
Was meinen Sie damit?
Große Technologieunternehmen profitieren von einem globalen System, in dem durch verschiedene Praktiken Gewinnmaximierung angestrebt wird. Dazu gehört Lohnarbitrage, also die Ausnutzung von Lohnunterschieden zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Hinzu kommt, dass Daten von Nutzer*innen ohne faire Entschädigung extrahiert werden. Und schließlich profitieren Unternehmen von den Vorteilen schwacher, fragmentierter Arbeitsschutzmaßnahmen und Datenregulierung, insbesondere im globalen Süden. Das vertieft die globale Kluft und reproduziert koloniale Ausbeutungsmuster, die nun einfach digitalisiert werden.

Joanita Najjuko aus Uganda arbeitet beim Nawi Afrifem Collective als Leiterin für digitale Ökonomien und die Zukunft der Arbeit. Die Initiative wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, eine Gemeinschaft afrikanischer Feministinnen und Organisationen aufzubauen.
Welche Länder und Regionen sind besonders betroffen?
Länder wie Kenia, Nigeria und Südafrika sind zu Hotspots für digitales Outsourcing in Afrika geworden. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind beispielsweise zahlreiche Content-Moderationsdienste ansässig, darunter auch für Facebook. Länder wie Indien und die Philippinen sind seit Langem etablierte Outsourcing-Standorte. In jüngerer Zeit beobachten wir auch eine Verlagerung in Konfliktregionen. Große Technologieunternehmen haben Teile der Demokratischen Republik Kongo, Somalia, den Südsudan und die Sahelzone ins Visier genommen. Dies ist vor allem auf Umbrüche in den traditionellen Arbeitsmärkten zurückzuführen. Mangelnde Arbeitssicherheit und wirtschaftliche Not machen die Arbeiter*innen verwundbar, insbesondere weibliche Beschäftigte.
Warum gerade weibliche Arbeitskräfte?
Da Frauen einen überproportionalen Anteil an der Pflege- und Hausarbeit tragen, sind sie mit besonderen wirtschaftlichen Schwachstellen und Hindernissen konfrontiert. Ihre Anerkennung und faire Entlohnung sind somit für jede Vision von Gerechtigkeit unerlässlich. In der Content-Moderation verrichten afrikanische Frauen unter oft unregulierten Bedingungen unterbewertete digitale Arbeit. Wir sehen darin eine Form der digitalen Care-Arbeit. Sie gewährleistet das Wohlergehen und die »Sauberkeit« digitaler Räume, bleibt aber oft unsichtbar und stark feminisiert. Dies ähnelt der Care-Arbeit in Haushalten, Krankenhäusern und Schulen, die trotz ihrer Bedeutung für den Erhalt von Wirtschaft und Gesellschaft systematisch abgewertet wird. Im Fall der Content-Moderation ist die Arbeit zusätzlich psychisch brutal. Moderatorinnen und Moderatoren sind grafischer Gewalt und Hatespeech ausgesetzt. Wir haben beobachtet, dass viele von ihnen unter Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, und wir sehen schwerwiegende Folgen, darunter auch Selbstmorde. Es gab auch Fälle, in denen Frauen während oder infolge ihrer Arbeit Fehlgeburten erlitten.
Was ist notwendig, um die Situation zu verbessern?
Ich glaube, dass weltweit durchsetzbare Arbeitsstandards das wichtigste Mittel sind, um den großen Tech-Unternehmen entgegenzuwirken. Ein Punkt ist eine verbindliche Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) für digitale Plattformen, die nicht nur Gig- und Plattformarbeiter*innen, sondern alle ausgelagerten Bereiche abdeckt. Wir sehen, dass auch traditionelle Arbeitsplätze zunehmend digitalisiert werden und neue Arbeitsformen entstehen. Und wir brauchen mehr regionale Standards, zum Beispiel durch die Afrikanische Union. Viele unserer Gesetze wurden einfach kopiert und dienen oft eher den Interessen der Unternehmen als dem Schutz der Beschäftigten. Das gilt für Arbeitsschutzvorschriften. Und wir müssen uns mit Themen wie Datenhoheit und Rahmenbedingungen für digitale Gerechtigkeit befassen, die über Löhne hinausgehen und auch die von Arbeiter*innen produzierten Daten einschließen. Durchsetzbare Protokolle zur psychischen Gesundheit sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es um die Moderation von Inhalten geht.
Welche Forderungen stellen Sie an die Länder des globalen Nordens?
Wir brauchen Sorgfaltsgesetze, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch sicherstellen, dass große Technologieunternehmen die Arbeitsstandards entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette einhalten und keine Schlupflöcher ausnutzen können. Es ist entscheidend, dass jede Strategie die Arbeiter*innen, insbesondere die am stärksten marginalisierten, in den Mittelpunkt stellt und einbezieht. Sie müssen als Gleichberechtigte agieren können und nicht nur als Bittsteller.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.