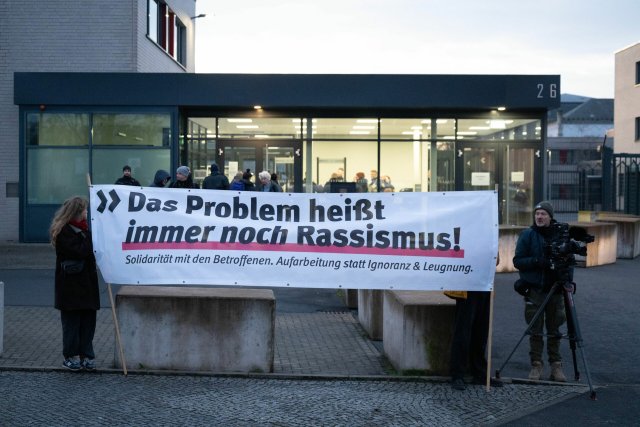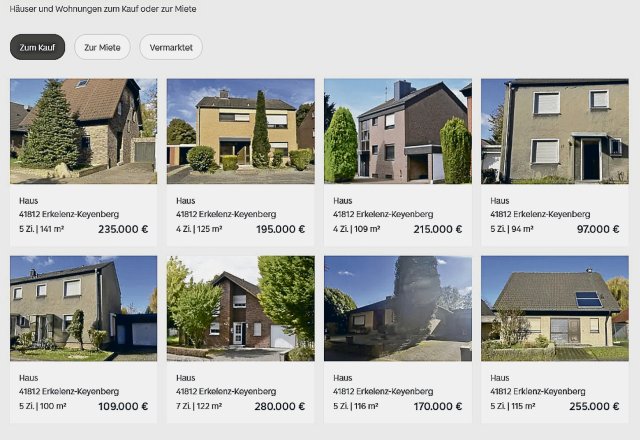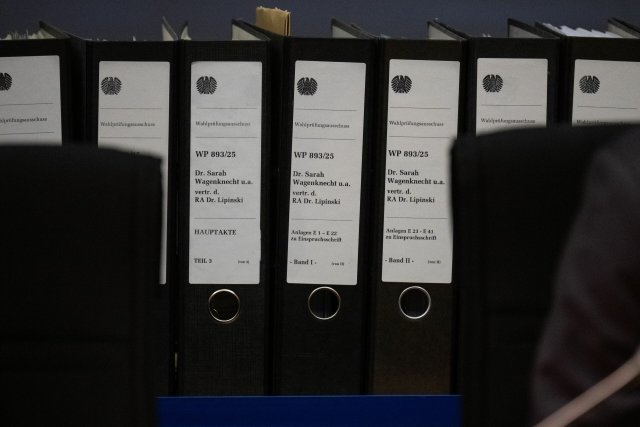- Politik
- Syrien
»Die Regierung muss den Frieden sichern«
Der Analyst Nanar Hawach erklärt, warum in Syrien die Integration ebenso wichtig ist wie die Bestrafung ehemaliger Assad-Tyrannen

Wie unsicher ist die aktuelle Situation in Syrien, besonders im Hinblick auf die wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen Drusen und Regierungstruppen in der südwestlichen Provinz Suweida?
Die Situation ist äußerst fragil. Der Waffenstillstand ist sehr instabil und kann leicht gebrochen werden. Es gab kürzlich wieder kleinere Gefechte, die zwar unter Kontrolle gebracht wurden, aber sie zeigen, dass ohne eine konkretere Vereinbarung die Lage weiterhin angespannt bleibt. Dies könnte zu einer weiteren Eskalation führen, da immer radikalere Elemente auf beiden Seiten gestärkt werden.
Wer sind die beteiligten Parteien in diesen Konflikten? Hauptsächlich Anhänger der Drusen, Beduinen und der Regierung?
Auf der einen Seite haben wir die Regierungstruppen, unterstützt von Beduinen aus verschiedenen Regionen, darunter auch solche aus Daraa und Deir ez-Zor. Die Beduinen sind weniger diszipliniert als die Regierungstruppen, was zu häufigeren Zwischenfällen führt. Auf der anderen Seite stehen die Drusen, die in verschiedenen Fraktionen organisiert sind, darunter der Syrische Militärrat und andere militante Gruppen. Diese Drusen sehen den Kampf als existenzielle Verteidigung.
Viele Mitglieder des Syrischen Militärrats haben unter dem Assad-Regime gedient.
Es stimmt, dass viele der militärischen Führer aus dem alten Regime kommen. Das ist ein großes Problem, weil sie mit einer neuen Realität zurechtkommen müssen. Aber sie sind erfahrene Kämpfer, und ihre Entschlossenheit, sich zu verteidigen, könnte zu einer langfristigen Bedrohung für die Stabilität der Regierung führen.

Als leitender Analyst für Syrien arbeitet Nanar Hawach bei der »International Crisis Group«. Für die Denkfabrik erforscht er die Konfliktdynamik, die Regierungsführung sowie nicht staatliche Akteure im Land. Zuvor analysierte er an der schwedischen Universität Uppsala die bewaffneten Konflikte im Nahen Osten und in Nordafrika.
Was bedeutet das für die Zukunft Syriens, insbesondere für die etwa 500 000 ehemaligen Soldaten des Assad-Regimes, die nun ohne Job dastehen?
Die alte Armee war riesig, und viele der ehemaligen Soldaten sehen sich heute als Verräter, da sie als »Felul« – Überbleibsel des alten Regimes – bezeichnet werden. Sie sind arbeitslos und haben keine Perspektive. Das ist ein großes Problem für die Stabilität des Landes, da sie zu einem fruchtbaren Boden für Aufstände werden können. Ohne Perspektive könnten viele von ihnen sich radikalisierten Gruppierungen anschließen.
Wie sollte die Übergangsregierung mit diesen ehemaligen Soldaten umgehen, um die Sicherheit und die Zukunft Syriens zu gewährleisten?
Die Regierung sollte dafür sorgen, dass die Sicherheit dieser ehemaligen Soldaten garantiert wird. Sie müssen als syrische Bürger behandelt werden – mit Bewegungsfreiheit und grundlegenden Rechten. Außerdem sollte die Regierung diejenigen, die für das neue Syrien kämpfen wollen, zurück in die Armee integrieren – nach einer gründlichen Überprüfung ihrer Vergangenheit. Für die Mehrheit, die nicht zurückkehren will, sollten zumindest kurzfristige Perspektiven wie Nahrungsmittelhilfen oder Unterstützungsprogramme geschaffen werden. Die Grundversorgung zu sichern, könnte dazu beitragen, dass sie sich nicht radikalisieren.
Wie steht es um die religiöse und ethnische Zusammensetzung der ehemaligen Armee? Spielt das eine Rolle in der aktuellen politischen Situation?
Die Armee bestand aus einer breiten Mischung von Ethnien und Religionen, aber in den höheren Rängen dominierten Alawiten. Diese Zusammensetzung trägt zur Entfremdung und Stigmatisierung der Alawiten bei, da die gesamte Gemeinschaft oft kollektiv für die Vergehen des Regimes verantwortlich gemacht wird. Wenn nach dem Krieg nur Alawiten vor Gericht gestellt werden, könnte das die Spannungen weiter verschärfen und das Gefühl verstärken, dass diese Gruppe Zielscheibe von Verfolgung wird.
Welche Maßnahmen wären notwendig, um diese Spannungen abzubauen und die Alawiten zu integrieren?
Es ist wichtig, eine Botschaft der Versöhnung zu senden. Das bedeutet, dass die Übergangsregierung klarstellen muss, dass sie nicht gegen die ganze Alawiten-Gemeinschaft vorgeht, sondern nur gegen die tatsächlichen Täter. Das würde helfen, das Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen. Gleichzeitig müssen Schritte unternommen werden, um die Alawiten nicht noch weiter zu isolieren, sondern aktiv in den Prozess der nationalen Versöhnung einzubeziehen.
Wie sehen Sie die Zukunft Syriens insgesamt? Gibt es Chancen für eine dauerhafte Stabilisierung?
Das ist schwer zu sagen, aber ohne eine grundlegende Veränderung in der Sicherheitsstrategie und einer besseren Integration der ehemaligen Soldaten in die Gesellschaft bleibt die Situation angespannt. Es gibt Potenzial für positive Veränderungen, aber die Regierung muss dringend den Weg der Versöhnung und des Dialogs gehen, um einen langfristigen Frieden zu sichern. Syrien ist sehr polarisiert. Manche Menschen schildern ein schönes Bild, andere ein düsteres, abhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder politischen Haltung. Ich war in vielen Teilen Syriens. In Gebieten mit Minderheiten ist die Sicherheitslage schlecht. In Regionen wie Homs verbessert sie sich, aber insgesamt ist die wirtschaftliche Lage schwierig. Wenn Sanktionen aufgehoben werden, bedeutet das nicht, dass plötzlich riesige Wolkenkratzer entstehen. Die Regierung ist stark zentralisiert – mit der islamistischen Miliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) als Gravitationszentrum. Das Land ist schwer zu beschreiben, es gibt viele unterschiedliche Realitäten.
Was ist mit Vertrauen? Viele fragen sich, ob man den neuen Machthabern angesichts ihrer islamistischen Vergangenheit überhaupt vertrauen kann.
Die Frage »Vertraust du dieser Person?« ist nicht der richtige Ansatz. Wichtig ist, ob man diesem Führer im Nahen Osten vertraut. Es geht mehr um Tendenzen zu diktatorischer Machtzentralisierung, um die Inklusion oder Exklusion bestimmter Gruppen. Ob sie der Islamische Staat sind oder nicht, ist eher nebensächlich – entscheidend ist, wie sie ihre Macht nutzen. Ein Ausschluss bestimmter Gruppen führt zu vielen Problemen und Gewalt. Die internationalen Beziehungen, die Übergangspräsident Ahmad Al-Scharaa im Eiltempo aufbaut, sind wichtig. Aber die internationale Gemeinschaft muss mehr Druck auf die syrische Regierung ausüben, um die destruktive Machtzentralisierung zu stoppen.
Würden Sie die Massaker in der Region Latakia oder in Suweida als Völkermord beschreiben?
Völkermord ist ein technischer Begriff, der in diesen Fällen nicht ganz zutrifft. Aber aus der Sicht der betroffenen Gemeinschaften fühlt es sich so an. In einigen Dörfern an der Küste wurden ganze Dörfer ausgelöscht – für die Überlebenden war das ein Völkermord.
Was ist mit der Verantwortung der Regierung?
Die Regierung hat in diesen Fällen versagt, sowohl in der Küstenregion um Latakia als auch in Suweida im Süden. Sie hat die Zivilisten nicht geschützt und die Verantwortung dafür von sich gewiesen. Die Schuld wurde auf andere geschoben, was die Legitimität der Regierung weiter untergräbt.
Was halten Sie von den Versprechen der Übergangsregierung, Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen?
Es ist wichtig, für Übergangsjustiz zu sorgen. Aber die Kommissionen, die gegründet wurden, spiegeln eher die Rhetorik der Regierung wider. Die Regierung gibt vor, dass »Einzelpersonen« verantwortlich seien, nicht die Regierung selbst. Damit hat sie versagt, das Vertrauen der betroffenen Gemeinschaften zu gewinnen.
Es gab vor fünf Monaten eine Übereinkunft zwischen der Übergangsregierung und den Kurden im Nordosten Syriens. Das ließ große Hoffnung aufkommen, jetzt ist die Situation wieder angespannter.
Die Verhandlungen zwischen der Übergangsregierung und den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) wurden durch Druck auf beide Seiten vorangetrieben, insbesondere nach den Massakern. Beide Seiten versuchten, Zeit zu gewinnen. Es fehlt jedoch an Vertrauen, besonders seit den Vorfällen in Suweida. Die SDF wollen ihre Waffen nicht abgeben, während die Regierung auf deren Kapitulation pocht. Das führt zu einem Stillstand.
Wie bewerten Sie die israelische Intervention in Syrien, besonders im Hinblick auf die Unterstützung der Drusen?
Israel möchte Syrien fragmentiert halten und unterstützt Minderheiten, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Israel tritt dabei nicht als Invasor auf, sondern als »Schutzmacht« einer bestimmten Gemeinschaft, was die Situation im Süden Syriens beeinflusst. Es ist klar, dass Israel weiterhin in dieser Rolle agieren wird.
Wie kommt es dann, dass Israel erst Syrien bombardiert, dann aber weiter mit der syrischen Seite verhandelt, wie jüngst etwa in Aserbaidschan?
Die Regierung in Damaskus will die Bedrohung durch Israel verringern und sieht den diplomatischen Weg als einzige Möglichkeit, dies zu erreichen. Bemerkenswert ist, dass sie diese diplomatische Herangehensweise gegenüber Israel versuchen, während sie die inneren Konflikte viel destruktiver angehen.
Glauben Sie, dass ein Friedensabkommen mit Israel in der Zukunft möglich ist?
Ein offizieller Friedensvertrag ist im Moment unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist ein Sicherheitsabkommen, das zumindest vorübergehend eine Art stabilisierende Funktion erfüllt.
Angesichts der Fragmentierung Syriens – was sehen Sie als die wichtigsten Schritte für die Zukunft an?
Wenn die Regierung weiterhin auf ausschließende Politik, übermäßige Gewaltanwendung und zentrale Machtkonzentration setzt, wird es zu weiteren Gewaltzyklen kommen. Die internationale Gemeinschaft hat einen Einfluss darauf, aber es liegt auch an den lokalen Akteuren. Wenn die Regierung inklusiver und dezentraler wird, könnte Syrien eine stabilere Zukunft haben. Es gibt Hoffnung. Aber ob sie sich erfüllt, hängt davon ab, ob Veränderungen in der Politik erfolgen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.