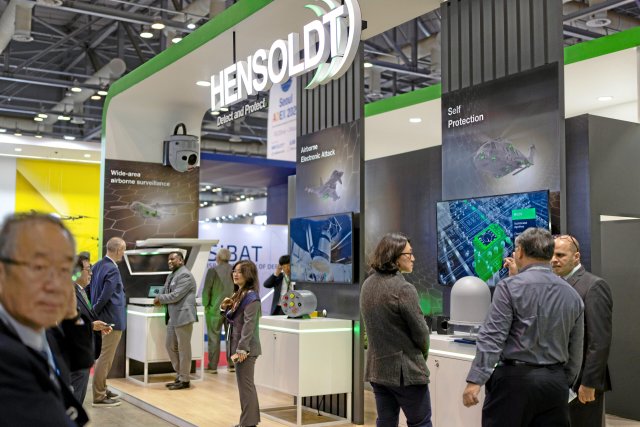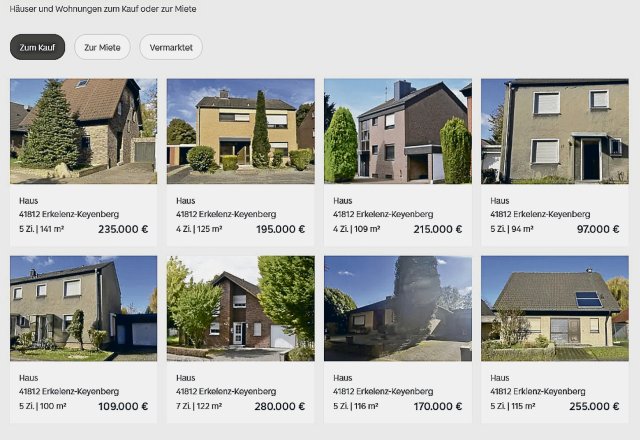- Politik
- Haushaltskürzungen in Frankreich
»Blockieren wir alles«
In Frankreich will eine Basisbewegung die geplanten Haushaltskürzungen stoppen. Premierminister Bayrou dürfte ihr erstes Opfer werden.

Wer mit dem Begriff »la rentrée« (Rückkehr) nichts anzufangen weiß, kennt Frankreich nicht. Am Wochenende davor gibt es noch einmal die berüchtigten Megastaus. Dann ist die Ferienzeit vorbei, die Schule beginnt, Paris schaltet zurück in den Normalbetrieb. Und auch die Politik meldet sich wieder zu Wort. Nach »la rentrée« werden die Weichen gestellt, was in den nächsten Monaten die Hauptthemen der Politik sein werden, welche Strömungen sich Vorteile erarbeiten können.
Die politische »rentrée« hat in der Regel ein Vorspiel. Das Ende der Urlaubszeit wird eingeläutet mit Ankündigungen der Regierenden. Werden diese Ankündigungen umgesetzt, wird in Frankreich der heiße Herbst eingeläutet.
Ein Vorbote dessen, was dieses Jahr zu erwarten ist, dürfte der 4. September gewesen sein. Die Energiesparte der Gewerkschaft CGT hatte angekündigt, mindestens 40 Einrichtungen zu blockieren. Zum ersten Höhepunkt kommt es dann aber am kommenden Montag. Ministerpräsident François Bayrou hat angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Nur zwei Tage später tritt ein neuer, völlig unbekannter Akteur ins Rampenlicht: die Basisbewegung »Bloquons Tout« (Blockieren wir alles). Für den 18. September wiederum kündigen die Gewerkschaften einen landesweiten Aktionstag an.
Bloquons Tout meldete sich erstmals im Mai in den sozialen Medien zu Wort – als Reaktion auf die Ankündigung des konservativen Ministerpräsidenten Bayrou. Der plant massive Haushaltskürzungen in Höhe von rund 44 Milliarden Euro, wobei ein großer Teil auf die soziale Infrastruktur, den öffentlichen Dienst und den Sozialbereich entfallen soll. Die Bewegung Bloquons Tout geht – wohl berechtigterweise – davon aus, dass Bayrou die Vertrauensabstimmung verlieren wird, denn dieser besitzt keine Mehrheit im Parlament und hat sich in der Vergangenheit seine Mehrheiten mithilfe des rechtsextremen Rassemblement national (RN) oder der Sozialisten gesucht. Inzwischen hat allerdings die gesamte Opposition angekündigt, ihm das Vertrauen zu verweigern. Bayrou fällt weich. Er ist während seiner Amtszeit als Ministerpräsident zugleich Bürgermeister von Pau geblieben.
Bei einer Umfrage befürworteten 63 Prozent der Befragten den Aufruf zur Blockade. Die drei Losungsworte »Boykott – Ungehorsam – Solidarität« reichen offenbar aus.
Weniger weich werden die Betroffenen der geplanten Kürzungsmaßnahmen fallen. In Planung ist die Streichung von zwei Feiertagen sowie der Karenzzeit ohne Lohnfortzahlung im öffentlichen Dienst bei Krankheit. Der Staatsapparat soll »verschlankt« werden, indem ausscheidende Beamte nicht ersetzt und Behörden abgeschafft werden, die die Regierung als »unproduktiv« ansieht. Vor allem aber sollen 2026 die Sozialleistungen und Renten nicht mehr wie bisher automatisch der Teuerung angepasst, sondern eingefroren werden. Eine Maßnahme, von der besonders die Armen und die unteren Einkommensschichten betroffen sind. Steigen soll lediglich der Militäretat, und zwar um 3,5 Milliarden Euro.
Bayrou hatte es ohnehin geschafft, in seiner achtmonatigen Amtszeit zum unbeliebtesten Ministerpräsidenten der V. Republik, also seit 1958, zu werden. Zuletzt erhielt seine Politik Zustimmungswerte von unter 18 Prozent. Das absehbare Ende seiner Amtszeit stellt Präsident Macron vor ein Dilemma. Denn da sich die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nach dem Sturz der durch ihn ernannten Regierung nicht verändern, könnten eigentlich nur Neuwahlen eine Lösung herbeiführen.
Allerdings stellte die Abgeordnete Alma Dufour von der linken La France Insoumise (LFI) im Fernsehen verblüfft fest, dass sie erstmals, am gleichen Tag und an der gleichen Stelle, mit der prominenten konservativen Politikerin Valérie Pécresse einer Meinung war, nämlich dass Neuwahlen keine wesentliche Veränderung zwischen den drei Blöcken im Parlament bringen würden und nur der Rücktritt Macrons und die Neuwahl des Präsidenten einen Ausweg bieten könnten. Eine Ansicht, die bei einer Meinungsumfrage vor einigen Wochen von einer knappen Hälfte der Befragten geteilt wurde und die inzwischen noch deutlich an Zustimmung gewonnen hat.
Letztlich handelt es sich nicht um eine Regierungskrise, sondern um eine veritable Systemkrise, in der neue Akteure den Ausschlag für die künftige Richtung geben können. In dieser Situation taucht Bloquons Tout auf, zunächst als Idee auf einem rechten Telegram-Kanal. Die Idee verbreitete und verselbständigte sich schnell, von rechten Einflüssen ist nichts mehr zu spüren.
Die politische Linke, deren Bündnis Nouveau Front Populaire längst faktisch zerfallen ist, ist mehr als dankbar für den Impuls von außen. Denn die Hoffnung, gemeinsam Druck von links machen zu können, ist gegenwärtig illusorisch. Als erste unterstützte deshalb Jean-Luc Mélenchons France Insoumise das Netzwerk Bloquons Tout; zuletzt aber auch die Sozialisten, die noch immer darauf hoffen, dass Macron ihnen mit ihren lediglich 64 Abgeordneten den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Inzwischen gibt es Zustimmung auch von einigen Gewerkschaften, von aktivistischen Umweltorganisationen wie den Soulèvements de la terre und von lokalen Attac-Gruppen.
Das Netzwerk fordert alle Abgeordneten auf, ihre Pflicht zu erfüllen, indem sie der Regierung das Vertrauen verweigern. Ansonsten ist Bloquons Tout diffus, unstrukturiert, hat kein Programm, verfügt über keine autorisierten Sprecher*innen. Trotzdem ist das Netzwerk in aller Munde. Inzwischen befürworten rund 63 Prozent der Befragten bei einer Erhebung des Instituts Toluna-Harris den Aufruf zur Blockade am 10. September. Ein Wert, der gegenwärtig wohl weder von den Parteien der Linken noch von den Gewerkschaften zu erreichen wäre. Die drei Losungsworte »Boykott – Ungehorsam – Solidarität« reichen offenbar aus. Die Bewegung zeigt sich entschlossen: »Sie haben uns ignoriert. Sie werden uns zu hören bekommen!«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Inzwischen gibt es um die 100 lokale und regionale Unterstützergruppen, deren Kommunikation über Telegram- und Signal-Kanäle läuft. Die Mobilisierung lief zunächst über die sozialen Medien, in denen Sharepics wie »Haushalt 2026 – Sie sollen bezahlen« und eine Auflistung der zehn reichsten Familien Frankreichs mit einem Gesamtvermögen von 442 Milliarden Euro zu sehen waren. Inzwischen finden auch lokale Vorbereitungstreffen statt – von Korsika bis Calais, mit zwischen 60 und mehreren hundert Teilnehmenden. Der Inlandsgeheimdienst zeigt sich beunruhigt und geht von 100 000 Teilnehmenden bei den angekündigten mehr als 60 Aktionen aus.
Viel erinnert an die soziale Bewegung der Gelbwesten. Dennoch wäre es wohl verfehlt, einfach von Gelbwesten 2.0 zu sprechen, denn dafür sind die Unterschiede zu deutlich. Nach einer Erhebung der Fondation Jean Jaurès bei 1100 Anhängern der neuen Bewegung speist diese sich größtenteils aus Anhängern der radikalen Linken, während die Gelbwesten weitaus heterogener waren und durchaus auch rechte Anteile hatten. Bei der Präsidentschaftswahl hatten nur zwei Prozent der Bloquons-Tout-Anhänger*innen Macron gewählt, nur drei Prozent die rechte Marine Le Pen. Stark vertreten sind die jüngeren Jahrgänge, deutlich überrepräsentiert die Alterskohorte zwischen 25 und 34 Jahre. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt bei den Bewohner*innen kleiner und mittlerer Städte, während die Großstädte und Paris eher unterrepräsentiert sind.
Letztendlich geben auch nur 27 Prozent der von der Fondation Jean Jaurès Befragten an, bei den Geldwesten aktiv gewesen zu sein. Arbeiter*innen und Rentner*innen, beides zentrale Gruppen für die Gelbwesten, sind bei Bloquons Tout geringer vertreten als in der Gesamtbevölkerung. 28 Prozent, damit deutlich mehr als insgesamt, gehören zu der Gruppe mit einem Netto-Einkommen zwischen 1250 und 2000 Euro, sind also selbst nicht von prekären Bedingungen betroffen, rutschen aber in die Prekarität, wenn ihnen etwas genommen wird. All diese Punkte bringen das Institut zu der Einschätzung, dass sich die neue Bewegung grundlegend von den Gelbwesten unterscheidet. 2025 wird also das Jahr, in dem es eine zweite »Rentrée« gibt. Die Rückkehr der sozialen Bewegungen auf die Straße.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.