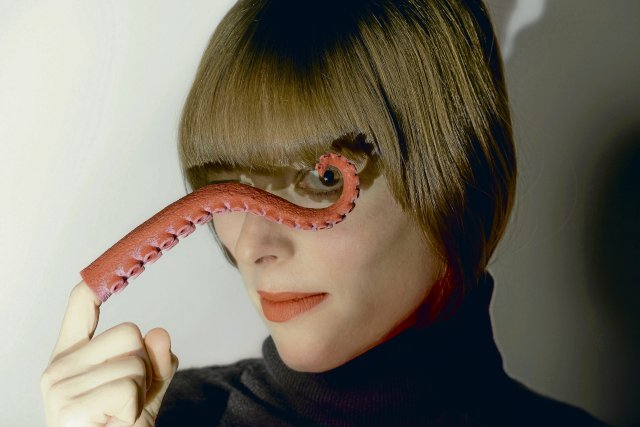- Kultur
- Querfront
Wolfgang Streeck: Irrweg mit Symptomatik
Der Soziologe Wolfgang Streeck galt vielen Linken als scharfer Kapitalismuskritiker. Wie wurde er zu einer Ikone der Querfront-Bewegung?

In den 1990er Jahren untersuchte die Populismusforscherin Karin Priester, wie aus ehemaligen »68ern« Neurechte wurden. Damals waren jene vor allem der philosophischen Schwurbelei erlegen und fanden ihren Weg etwa über Martin Heidegger zu einer neurechten Agenda, die bis heute beispielsweise in der Zeitschrift »Tumult« weiterwirkt. Zur gleichen Zeit stellte der Literatur- und Politikwissenschaftler Jost Müller anhand eines ehemaligen 68ers eine Tendenz fest, dass man sich aus Narzissmus und intellektueller Überheblichkeit heraus das »kultivierte Gespräch mit einem intelligenten Faschisten« wünsche. Bis heute gilt dabei Müllers Urteil über solche Wünsche: »Das Desaster setzt da ein, wo sich intellektueller Narzißmus mit geschwätziger Criss-Cross-Plauderei, Arroganz mit Ignoranz paart.« Die Zeiten haben sich geändert, das Desaster hat sich vergrößert.
In den letzten Jahren der multiplen Krise waren wieder größere Diffusionsbewegungen innerhalb der politischen Landschaft zu verzeichnen. Es sind nicht mehr, wie noch in den 1980er Jahren, ehemals authentizitätsbegeisterte, ins Mythische abgedriftete Linksradikale, die großen Gefallen an der Selbstberauschung des vermeintlich provokanten Geschreibes gefunden haben. Sondern es zerfasert nun ein Milieu, das vormals fest in der linken Sozialdemokratie beheimatet war. Die Geister scheiden sich hier an den Grundfragen zur Stellung zu Europa und dem Nationalstaat, die Linien wurden aber bereits sichtbar in Bezug auf Corona und Russland.
Ein Grenzgänger, der die Brüche in diesem linken Milieu markiert, ist der bekannte Soziologe Wolfgang Streeck. Durch seine Abkehr von der neoliberalen Sozialdemokratie erschreibt er sich spätestens 2012 mit seinem Buch »Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus« einen Ruf als Kapitalismuskritiker und publiziert auch rege in linken Zeitschriften wie dem »New Left Review«. Ohne dass sein Ruf davon geschädigt würde, wirkt Streeck heute zugleich als organischer Intellektueller des BSW, tritt bei der verschwörungsideologischen Partei Die Basis ebenso auf wie in der neurechten Bibliothek des Konservatismus und gibt Interviews mit Neofaschisten wie Benedikt Kaiser in der neurechen Zeitschrift »Die Kehre« oder dem Blatt »Élélementes« der Nouvelle Droite. Worin besteht aber die Faszination mit Streeck für Linke wie für Rechte und was sagt das über den intellektuellen Zustand eines ehemals linken Milieus?
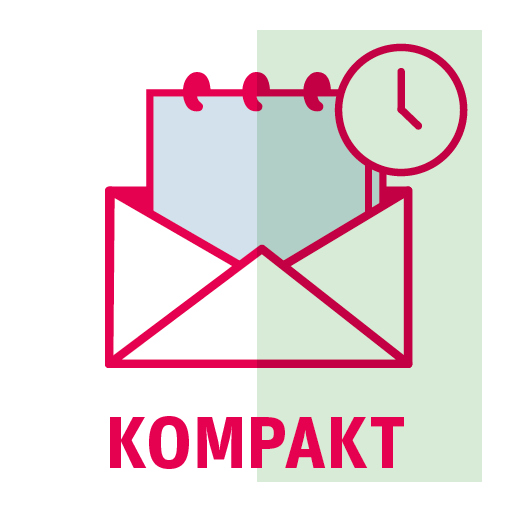
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Weder rechts noch links
Das Mäandern zwischen den Milieus ist für Wolfgang Streecks Position bezeichnend. Denn es sei ihm »gleichgültig«, wie er im Interview mit der faschistischen Zeitschrift »Die Kehre« sagt, ob ein Bedürfnis danach, das »Neueste vom Neuen kritisch« zu betrachten, »›rechts‹ oder ›links‹ zu Hause« sei. Ähnlich feiern Akteure der Neuen Rechten wie beispielsweise Constantin von Hoffmeister auf dem neofaschistischen Blog »Eurosibiria« sowohl die Erfolge der AfD als auch des BSW nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Dies signalisiert für von Hoffmeister das »Wiederaufleben einer starken nationalbolschewistischen Strömung«. Solcherlei Querfront-Betätigungen legitimiert Wolfgang Streeck durch seine Texte. Ganz im Sinne neurechter Begriffsverwirrungen stellt er einen neuen Hauptwiderspruch her, der die jüngste Moderne als Gegensatz zu einem untergegangenen Zustand behauptet, zu dem mittels Rückbesinnung auf das Nationale zurückgekehrt werden müsse.
Für Streeck und die national-soziale Strömung der gesellschaftlichen Linken ist dieser verklärte Zustand der fordistische Wohlfahrtsstaat der 1970er Jahre. Hier sei die Welt noch in Ordnung gewesen, bevor die zunehmend neoliberale Globalisierung einsetzte. Streeck zufolge liegt dieser Globalisierung der Widerspruch zwischen »Marktvolk« (globale Unternehmen, Investoren und Regierungen) und »Staatsvolk« zugrunde. Die Veränderungen in den Klassenverhältnissen werden so von vorneherein durch eine nationale Brille betrachtet. Konsequenterweise taucht die Arbeiter*innenklasse für Streeck auch nur als Arbeiter*innenschaft auf, die zuvor national organisiert gewesen sei und den Angriffen des globalen Kapitals und des Kosmopolitismus ausgesetzt wurde. Reale Transnationalisierungsprozesse der Arbeiter*innenklasse selbst sind in diesem national gesetzten Analyserahmen nicht erkennbar.
Rechten Kulturkämpfer*innen gefällt diese Sichtweise. Streeck kann als unangepasst und rebellisch gelten, wenn er Vorträge im neurechten Milieu hält, wo er schließlich aber nur allzu Beliebtes erzählt. Bei seinem Vortrag 2023 in der Bibliothek des Konservatismus, einem zentralen Thinktank der Neuen Rechten in Deutschland, sah das dann so aus: Streeck forderte lächelnd und mit erhobenen Zeigefinger eine »konservative Revolution« und regte an, den Sozialstaat der 1970er Jahre doch als konservatives Vorbild zu nehmen. Und er stimmte ein in das linke »Lob der Nation«, mit dem etwa Michael Bröning den Nationalstaat verteidigte, das gegen einen angeblich antinationalen Mainstream gesetzt werden müsse.
Anschluss an die Rechte
Vom Lob der Nation ist es nicht weit zu Antimigrationsfantasien. In einem Lob des BSW 2024 im »Freitag« bringt Streeck das rechte Propagandawort der »unbegrenzten Einwanderung« entgegen jede empirische Realität in Anschlag und bezieht dies, ebenfalls der rechten Erzählung folgend, auf den Sommer der Migration 2015. Dass es bereits im Herbst 2015 eine erste Asylrechtsverschärfung in Deutschland gab, der kurz darauf eine weitere folgte, ignoriert Streeck ebenso beharrlich wie die europäischen Verschärfungen bezüglich Migration, die schließlich im gemeinsamen europäischen Asylsystem Geas mündeten. Ebenso ignoriert er, dass es tatsächlich keine No-Border-Linken waren, die diese Verschärfung lange Zeit verzögerten, sondern die Widersprüche zwischen Melonis Italien und Orbans Ungarn.
Im »New Left Review« sinnierte Streeck enttäuscht über das Wahlergebnis des BSW und die Gründe, warum so viele Arbeiter*innen AfD gewählt hätten. Die Arbeiter*innen, die nicht wählen dürfen oder nicht AfD gewählt haben, zog er dabei nicht in Betracht. So wird die rechte Erzählung der AfD als soziale Partei reproduziert. Streecks Demokratievorstellung von nationaler Souveränität und Homogenität nähert sich vom ehemals sozialdemokratischen Milieu aus der neurechten Ideologie an. Schließlich leistet er durch die Dichotomisierung von Nation und Globalismus der neurechten Verwandlung von Antikapitalismus in Antiliberalismus Vorschub.
Der liberalismusfeindliche Einschlag zeigt sich auch, wenn Streeck die Klimakrise von einem globalen Problem des Überlebens der Menschheit zu einer rein moralischen Frage abwertet. Die notwendigen Anpassungen von Städten an veränderte klimatische Bedingungen verspottet er als Frage von »tugendhaften Städten« oder kanzelt Klimaschutz als »Religion« ab. Konsequenterweise muss er globale Probleme aus den nationalen Fantasien heraushalten und als falsche Moralvorstellungen abwehren. Das intellektuelle nationale Querdenkertum, für das er spricht, nähert sich auch hier der Rechten an. In dieses Bild fügt sich auch die laute Ablehnung gendersensibler Sprache – »die eigenartigen Schreibweisen und komischen Glottallaute«, wie Streeck es nennt – und der Vorstellung, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Versuche einer nicht-diskriminierenden Alltagspraxis werden dann wiederum Umverteilungspolitiken entgegengestellt.
Zurück zum Antiliberalismus
Allerdings tritt die soziale Frage derzeit ohnehin hinter die Friedensfrage zurück. Der Angriff Russlands auf die Ukraine wird im nationalen Analyserahmen der geopolitischen Situation der 1970er Jahre gedeutet. In einem Vortrag 2024 bei einer Konferenz der verschwörungsideologischen Partei Die Basis geht Streeck von der Annahme aus, dass Nationalstaat und Souveränität eine »Waffe der Schwachen gegen die Starken sind« und deshalb vom »Imperium«, den USA, »verweigert oder beschnitten« würden. Gleichzeitig blendet er die imperialen Kriege Putins und Russlands aus und spricht damit implizit jegliche eigene Handlungsinteressen ab. Dass er auch eine »multipolare Weltordnung« mit einem blockfreien Europa fordert, dürfte insbesondere die Europa-Strategen der Neuen Rechten freuen, die auf ähnliches hoffen. In einem Artikel über den Ukraine-Krieg – erschienen in einem Sammelband im verschwörungsaffinen Westend-Verlag und herausgegeben von der ersten Vorsitzenden des rechten Professor*innenverbands Netzwerk Wissenschaftsfreiheit – klopft Streeck dann auch den von ihm abgelehnten Kosmopolitismus in der Formel »Amerikanismus als Universalismus« in antiliberaler Tradition fest.
Die politischen Grenzgänge, das Mäandern zwischen linken, verschwörungsaffinen und offen rechten Milieus: All dies fußt letztlich auf Streecks Verwechslung von Nation mit Befreiung und seinen Übergang vom Antikapitalismus zum Antiliberalismus. Sozialpsychologisch wäre zu fragen, ob diese Nationalstaatsnostalgie nicht auch einer Trauer über den Verlust der eigenen Bedeutung im Wissenschaftsgefüge entspringt. Denn genau an jenen Punkten werden aktuelle Sozialwissenschaften abgelehnt oder ignoriert, an denen sie noch einen gesellschaftlichen Einfluss haben: in der Antidiskriminierungsarbeit, den gesellschaftlichen Fortschritten in Gleichstellungsfragen von sexueller Orientierung oder Non-Binarität. Hier wird der vermeintlich linke Kämpfer der Arbeiterklasse zum bloßen Kulturkämpfer. Ironischerweise fällt Streeck hier auf jene regressiven Naturvorstellungen zurück, mit denen der autoritär bis faschistische Strang des Neoliberalismus gesellschaftliche Ungleichheiten legitimiert.
Streeck spricht damit für ein Milieu, das seine wissenschaftliche Autorität aus der Nähe zur Macht schöpfte und sich nun, nach dem Verlust dieser Nähe, in Querdenkertum suhlt. Dabei wird jede eigene Situiertheit ausgeblendet und man kann sich als ignorant gegenüber den Bedürfnissen der Drangsalierten der kapitalistischen Produktionsweise zeigen. Statt Solidarität liebäugelt man mit einer nationalen Pseudorebellion und den politischen Kräften des Faschismus.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.