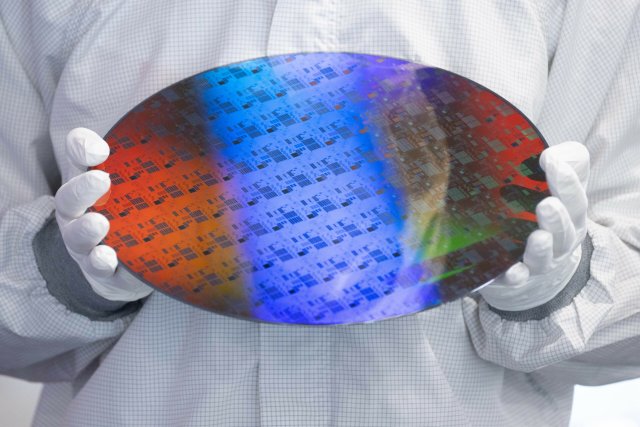- Wirtschaft und Umwelt
- Welttag der Suizidprävention
Hilfsangebote fehlen oder werden nicht genutzt
Welttag der Suizidprävention: Verbesserung der psychiatrischen Versorgung auch in Deutschland angemahnt

Im Jahr 2023 starben in Deutschland etwa 10 300 Menschen durch einen Suizid – deutlich mehr Männer als Frauen. Das entsprach demnach etwa einem Prozent aller Todesfälle hierzulande. Weltweit nahmen sich zuletzt jedes Jahr mehr als 720 000 Menschen das Leben.
Zu diesen Zahlen gibt es eine gute Nachricht: Die Suizidraten verringerten sich in den vergangenen Jahrzehnten. In Deutschland hatten sie sich seit den 80er Jahren nahezu halbiert, nahmen aber ab 2008 wieder leicht zu. Seit dem Jahr 2005 variieren die absoluten Zahlen leicht um 10 000 Fälle pro Jahr.
International können zwischen 1990 und 2021 ebenfalls sinkende Suizidraten verzeichnet werden, wie kürzlich eine Auswertung der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergab, und zwar global um 30 Prozent. Demnach sind die Raten in den einkommensstarken Ländern etwas höher, und zwar gerade in den nordeuropäischen Ländern. Hier bestätigt sich, dass mit einem höheren Entwicklungsindex und Breitengrad die Suizidraten steigen. Männer trafen diese Entscheidung im Jahr 2021 etwa 3,57-mal so häufig wie Frauen. Ebenso sind ältere Personen häufiger betroffen als jüngere.
Die Herausforderungen, Suizide zu vermeiden, sind auch deshalb vielfältig. Benannt werden sie an jedem 10. September, der seit 2003 als Welttag der Suizidprävention begangen wird. Unter anderem geht es darum, Mythen zu entkräften, die sich um das Thema ranken, und die offene, empathische Debatte zu stärken, damit es Menschen gelingt, sich Hilfe zu suchen.
Schon in den westlichen Ländern allein bestehen große Unterschiede bei den Suizidraten, je nach soziokulturellen Rahmenbedingungen, zu denen Alkoholkonsum und die Qualität medizinischer Versorgung gezählt werden müssen. Die Unterschiede reichen bis dahin, wie Menschen mit Lebenskrisen umgehen.
Bis zu 90 Prozent der Suizidopfer seien psychisch krank und litten an gut behandelbaren psychischen Erkrankungen wie Depression und Alkoholabhängigkeit, erklärte vor einiger Zeit die psychiatrische Fachgesellschaft DGPPN. Ute Lewitzka hält diese Zahl für zu hoch. Die Psychiaterin von der Goethe-Universität Frankfurt am Main ist Deutschlands erste und einzige Professorin für Suizidforschung.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Lewitzka sieht unter anderem die Gabe von Lithium als eine zu wenig genutzte Therapie zum Ausgleich krankhaft stark schwankender Stimmungen, was am Ende möglicherweise auch Suiziden vorbeugen kann. Das Salz kommt in minimalen Spuren auch im Trinkwasser vor. Je höher dieser Anteil ist, desto niedriger war die Suizidrate laut einer australischen Metaanalyse von 2020. Dabei wurden die entsprechenden Daten für 113 Millionen Menschen aus fast 2700 Regionen weltweit verglichen.
Eine Umfrage des Science Media Centers zum Thema ergab bei mehreren beteiligten Experten eine ganze Reihe von bewährten Präventionsansätzen. Dazu gehört einerseits der niedrigschwellige Zugang zu anonymen Beratungsstellen und Krisendiensten sowie ingesamt eine gute psychologische Versorgung gerade von benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Andererseits müsse der Zugang zu tödlichen Mitteln wie Schusswaffen oder Pestiziden erschwert, bestimmte Medikamente sollten nur in kleinen Packungen abgegeben werden.
Ein deutliches Manko bei dem Thema besteht offenbar in der vernachlässigten Erforschung von Suizidalität, was einerseits am gesellschaftlichen Stigma liegt, andererseits aber auch daran, dass hier sehr viele Einflüsse zusammenwirken, darunter solche gesundheitlicher, ökonomischer und kultureller Art. In Deutschland fehlt zudem explizit ein Suizidpräventionsgesetz, obwohl der Bundestag dies in der letzten Legislaturperiode mit überwältigender Mehrheit gefordert hatte.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.