- Wirtschaft und Umwelt
- Schrottimmobilien
Duisburg: »Räumungen dienen der Unterdrückung«
Bei den Praktiken gegen sogenannte Problemimmobilien geht Duisburg als Negativbeispiel voran

Was halten Sie von den jüngsten Ideen aus NRW, sogenannte »Schrottimmobilien« schneller an Kommunen zu veräußern und, wie es aus der Staatskanzlei heißt, »Menschen zu schützen«?
Dieser Vorschlag ist nicht neu. Schon 2019 legte ein Papier den Erwerb von »Problemimmobilien« durch Kommunen als strategisches Ziel fest. Zur Finanzierung wurde ein Stadtentwicklungsfonds eingerichtet. Insgesamt ist die Idee sinnvoll. Es gibt Beispiele aus Städten wie Dortmund, wo Immobilien den Besitzer wechselten, renoviert wurden und nun ein erschwingliches und sicheres Wohnumfeld bieten, das den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entspricht. Ich befürchte jedoch, dass in Duisburg, wo Migranten offen feindselig begegnet wird, solche Käufe dazu genutzt werden könnten, diese Immobilien vom Markt zu nehmen oder sie anderweitig für die lokale Bevölkerung unbenutzbar zu machen. Derzeit verzögert die Stadt aktiv den Aufkauf solcher Immobilien. Dadurch wird das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in von Migranten dominierten Stadtvierteln effektiv reduziert. In der aktuellen Debatte über »organisierten Sozialmissbrauch« werden »Problemimmobilien« als »Anreizfaktor« für Migranten aus Südosteuropa identifiziert. Das bereitet mir wirklich Sorgen. Und: Derartiges führt zur Kriminalisierung von Sozialleistungsempfängern. Wir erleben hier einen klaren Rechtsruck in der Debatte.
Was genau sind eigentlich diese »Schrottimmobilien«?
Eine »Problemimmobilie« ist dem NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zufolge »eine nicht angemessen genutzte und/oder bauliche Missstände (Verwahrlosung) aufweisende Liegenschaft, die negative Ausstrahlungseffekte auf ihr Umfeld verursachen kann und die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt oder den geltenden Vorschriften zu Umgang, Nutzung und Bewirtschaftung nicht entspricht«. Oder eben auch städtebaulichen Entwicklungszielen entgegensteht. Der Diskurs über »Problemimmobilien« ist seit seinen Anfängen direkt mit jenem der »Migration aus Südosteuropa« verbunden. So schrieb das Ministerium für Heimat: »Bevölkerungsgruppen, die über wenig Einkommen verfügen oder von Benachteiligung bei der Wohnungssuche bedroht sind, wohnen überproportional hier.« Und: »Auch die innereuropäische Zuwanderung aus Südosteuropa richtet sich an diese Viertel.«

Polina Manolova ist Soziologin und Aktivistin bei Stolipinovo in Europa, einer Migrant*innen-Selbsthilfeinitiative in Duisburg.
Wer sind die Menschen, die in solchen Gebäuden leben müssen?
In der Regel handelt es sich dabei um Neuankömmlinge, die wegen diskriminierender Praktiken oder unerfüllbarer bürokratischer Kriterien keinen Zugang zum regulären Mietmarkt haben. Menschen mit Schufa-Eintrag, also solche mit erheblichen Schulden, die von privaten Vermietern und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften abgelehnt werden. Es ist also eine Kombination aus ethnischer Diskriminierung und sozioökonomischer Prekarität, die Menschen in diese informell verwalteten Wohnverhältnisse drängt. Diese »Problemimmobilien« sind oft die einzige Möglichkeit, sich eine Unterkunft zu sichern und der Obdachlosigkeit zu entkommen.
Wieso geht die Stadt Duisburg so brutal mit ihrer »Task force« gegen die Gebäude und vor allem gegen die Mieter vor?
Die Kommunalbehörden verfügen über eine Vielzahl politischer Instrumente, um Mängel an solchen Objekten zu beheben. Die Stadt Duisburg hat hier einen einzigartigen Ansatz verfolgt, indem sie 2014 die »Task Force Problemimmobilien« ins Leben gerufen und seitdem mehr als 5000 Personen in über 200 Immobilien aus ihren Wohnungen vertrieben hat. Ich bin der Meinung, dass ein solcher Ansatz und die brutalen Mittel, mit denen die Räumungen durchgeführt werden – ohne vorherige Ankündigung an die Bewohner und ohne Angebot alternativer Wohnmöglichkeiten –, eine Säuberung der Stadt von unerwünschten ethnischen und nationalen Gruppen darstellen. Sören Link, der Oberbürgermeister von Duisburg von der SPD, hat in den vergangenen Jahren offen seine Absicht bekundet, Menschen aus Bulgarien und Rumänien zu vertreiben und durch Vertreter anderer ethnischer und nationaler Gruppen zu ersetzen. In diesem Sinne sehe ich Zwangsräumungen weniger als Instrument der Wohnungspolitik, sie dienen vielmehr der Unterdrückung und Bevölkerungskontrolle.
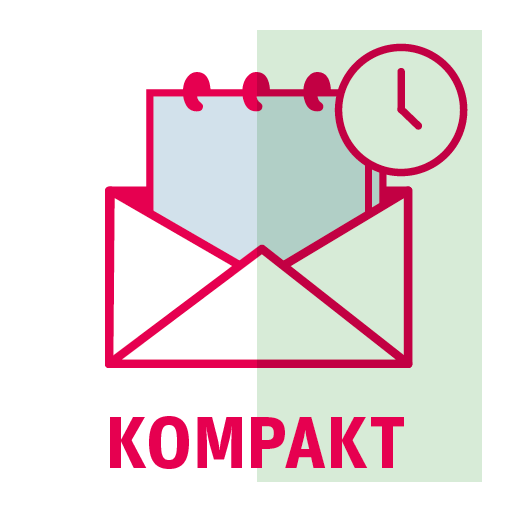
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Ist die Europäische Freizügigkeit nicht auch ein Grund, dass viele Menschen gerade aus Bulgarien und Rumänien von kriminellen Vermietern »abgezogen« werden können? NRW fordert, den Zugang zum deutschen Sozialsystem für diesen Personenkreis einzuschränken.
Es ist nicht die europäische Freizügigkeit an sich, die die Ausbeutung von Migranten durch kriminelle Vermieter begünstigt. Das Problem ist komplex und hängt mit der Finanzierung des Wohnungsmarktes in Deutschland zusammen, insbesondere seit 2019. Der Rückgang des sozialen Wohnungsbaus und die lokalen sozialpolitischen Ansätze, die Migranten als Mieter benachteiligen, anstatt skrupellose Vermieter zu bestrafen, spielen ebenfalls eine Rolle. In diesem Sinne ist der Vorschlag, den Zugang zu Sozialleistungen zu beschränken, kontraproduktiv. Durch die Einschränkung der sozialen Unterstützung für die am stärksten benachteiligten Gruppen erhöhen die Behörden das Risiko von Obdachlosigkeit und extremer materieller Not für Migrantengruppen.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







