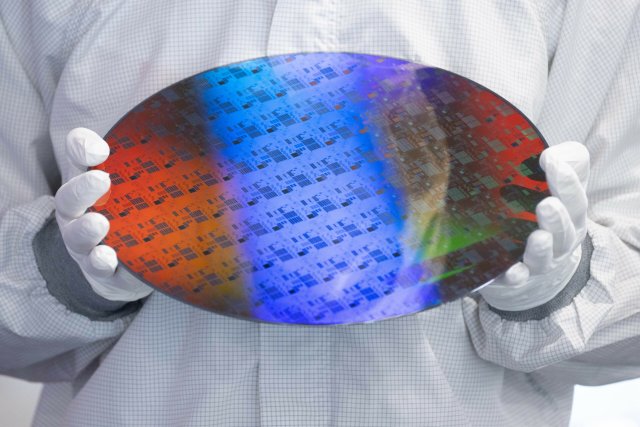- Wirtschaft und Umwelt
- Zinssätze
EZB-Geldpolitik bald moderater?
Für die Europäische Zentralbank könnte die Realwirtschaft wichtiger werden

Wird die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag erneut ihre Zinsen senken? Analysten sind in ihren Erwartungen eher skeptisch. Möglicherweise wird der EZB-Rat unter Präsidentin Christine Lagarde den Leitzins nach acht Zinsschritten innerhalb nur eines Jahres bei zwei Prozent belassen, um sich für die Zukunft ausreichend Spielraum zu erhalten.
Überschattet wird das Treffen der EZB-Spitze von einem Milliarden-Debakel der Bundesbank. Deren Zentrale, ein Betonkoloss aus dem Jahr 1967, soll seit Jahren saniert werden. Neu gebaut werden sollten im Umfeld in Frankfurt am Main zusätzlich Hochhäuser, eine Kita und anderes. Was den Bundesrechnungshof auf den Plan rief. Die aktuellen Kosten für die ursprüngliche Planung beziffert der Rechnungshof auf rund 4,6 Milliarden Euro. »Das entspricht für einen Büroarbeitsplatz 1,02 Millionen Euro«, so die Prüfer.
Nun sollen die Pläne geschrumpft werden. Übrig bleibt die Sanierung des Hauptgebäudes. Auch schon ein komplexes Vorhaben, denn das Gebäude enthält Schadstoffe und steht seit 2022 unter Denkmalschutz. Hinzu kommen die Wirkungen eines Personalwechsels: 2022 übernahm der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel das Projekt namens »Campus« von seinem Vorgänger Jens Weidmann, einst Assistent von Angela Merkel (CDU). Weidmann galt als Verfechter einer straffen Geldpolitik (mit hohen Zinssätzen) und sparsamen Haushaltens.
SPD-Mitglied Nagel gilt als moderater. Der Personalwechsel mag zum Strategieschwenk der Zentralbank beigetragen haben, den Präsidentin Lagarde im Juni offiziell verkündete. Eine »Revolution«, meint der eher im linken Ökonomenlager verortete Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in der Fachpresse.
Nach den europäischen Verträgen ist die EZB ausschließlich dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet. Sie bestimmt jedoch selbst, mit welcher Strategie sie es verfolgt. Nun hat sie diesen Rahmen formal nur geringfügig, in der Praxis jedoch weitgehend verändert. Zwar bleibt das Inflationsziel von zwei Prozent in der mittleren Frist bestehen. Neu ist jedoch, dass die EZB künftig die (negativen) Folgen ihrer Geldpolitik auf die Realwirtschaft ernst nehmen will.
So könnte sie künftig auf Zinserhöhungen verzichten, mit denen sie beispielsweise auf die seit Sommer 2021 extrem steigenden Energiepreise reagierte. Zinserhöhungen, mit denen sie die Konjunktur abwürgte. Ein Schock, von dem sich etwa die deutsche Wirtschaft bis heute nicht erholt hat.
Damit verliert das Inflationsziel wie schon in den USA seine uneingeschränkte Vorrangstellung – und größere Abweichungen von diesem Ziel könnten länger in Kauf genommen werden. Die neue Unbestimmtheit könnte die Glaubwürdigkeit der Institution schwächen und politische Begehrlichkeiten wecken – wie ein Blick über den Atlantik zeigt, wo US-Präsident Donald Trump seit Monaten die Zentralbank Fed attackiert, sie solle endlich ihre Leitzinsen senken. Die Federal Reserve (Fed) verfügt über ein duales Mandat: Preisstabilität und maximale Beschäftigung. Was ihr erlaubt, zwischen beiden Zielen zu gewichten.
Nun hat sich auch die EZB mehr Flexibilität verordnet. Doch Beschäftigung und Konjunktur sind nicht die einzigen Herausforderungen. Darum dreht sich der »Innovationsgipfel«, den die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Zentralbank der Zentralbanken, während dieser Woche in Basel durchführt. Kryptowährungen, Klimakrise und Finanzkriminalität sind einige der großen Themen. Dabei kann Vielfalt überfordern. Mit der Finanzkrise 2007 bis 2009 waren die Notenbanken zu einem »Lender of last Resort« geworden, zum Kreditgeber letzter Instanz und damit zum Retter in der Not. Aber sie sollten sich nicht zum »revolutionären« Retter in jeder Not erheben.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.