- Wissen
- Leichtathletik-WM
Geschlechtstest: Die Uneindeutigkeit der Gene
Ein neuer verpflichtender Geschlechtstest für weibliche Leichtathletinnen fußt auf wissenschaftlich fragwürdigen Grundlagen

Weniger als zwei Monate vor Beginn der Leichtathletik-WM in Tokio am 13. September gab die durchführende Organisation World Athletics eine neue Voraussetzung für die Teilnahme am Frauensport bekannt: Athlet*innen müssen einen Geschlechts-Gentest durchführen lassen. Dabei soll das Nichtvorhandensein des SRY-Gens (Sex determining region of Y), nachgewiesen werden, »ein verlässlicher Proxy, um das biologische Geschlecht festzustellen«, so World Athletics. Laut Präsident Sebastian Coe gehören »der Schutz und die Förderung der Integrität des Frauensports« zur Philosophie der Organisation. Wer auf Elite-Niveau im Frauensport antrete, müsse daher »biologisch weiblich« sein.
Mit seiner Positionierung greift der Verband eine gesellschaftliche Diskussion um trans und intergeschlechtliche Sportler*innen auf, die, von rechten und transfeindlichen Aktivist*innen und Internet-Mobs gefüttert, in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgte.
Die Schwierigkeit binärer Kategorien
Die Schwierigkeit, Geschlecht als binäre Kategorie anzuwenden, ist nicht neu in der Geschichte des Spitzensports. Im Jahr 2009 diskutierte das internationale Sportpublikum in menschenverachtender Weise über das Geschlecht der südafrikanischen Athletin Caster Semenya, die mehrfach Goldmedaillen im 800-Meter-Lauf gewann. Aufgrund ihrer als »unweiblich« gelesenen Geschlechtsmerkmale wie Aussehen und tiefe Stimme wurde ihr Frausein infrage gestellt und Semenya musste sich einem Geschlechtstest des damals noch als International Association of Athletics Federations (IAAF) firmierenden Leichtathletikverbands unterziehen. Zwar durfte Semenya ihre Medaillen behalten, doch im Zuge der Kontroverse führten IAAF und Olympisches Komitee mehrmals neue Zugangsvoraussetzungen für den Frauensport ein. Deren wissenschaftliche Grundlagen sind jedoch jeweils höchst fragwürdig.
So veröffentlichten die führenden IAAF-Ärzte Stéphane Bermon und Pierre-Yves Garnier 2017 eine Studie, in der sie einen kausalen Zusammenhang zwischen bestimmten Testosteronwerten von Sportlerinnen und ihren Leistungen beschrieben. Sie diente als Grundlage für Regeln, nach denen Sportlerinnen ihr Testosteron künstlich senken mussten, um an bestimmten Disziplinen teilzunehmen. Caster Semenya wurde beispielsweise bei der Olympiade in Tokio 2021 vom 800-Meter-Rennen ausgeschlossen, da sie eine Hormonbehandlung verweigerte. Anfang 2019 wurde die Studie von Bermon und Garnier angezweifelt und inzwischen wurde sie von der veröffentlichenden Fachzeitschrift zurückgezogen. Das Team von Roger Pielke Jr. von der University of Colorado hatte die zugrundeliegenden Daten neu analysiert und »sigifikante Anomalien und Fehler« festgestellt.
Von Hormonwerten zur Genetik
Da Hormonwerte die zweifelsfreie Geschlechtseinteilung nicht leisten können, hat sich World Athletics nun der vermeintlich eindeutigen Genetik zugewandt. Doch Geschlecht ist auch auf dieser Ebene keine binäre Kategorie. So wie die Verteilung unbehandelter Testosteronwerte überlappt, gibt es auch genetisch diverse intergeschlechtliche Abweichungen. Das Gen SRY, dessen Vorhandensein bei den meisten Personen die Entwicklung Testosteron produzierender Hoden auslöst, kann auch bei Menschen mit weiblichen Geschlechtschromosomen (XX) auftauchen. Und bei Menschen mit XY-Chromosomensatz kann es vorkommen, dass sie SRY besitzen und Testosteron produzieren, aber das Hormon durch eine Abweichung an den Rezeptoren keine Wirkung zeigt (Androgenresistenz). SRY kann zudem auch vorliegen, aber durch eine kleine Abweichung inaktiviert sein.
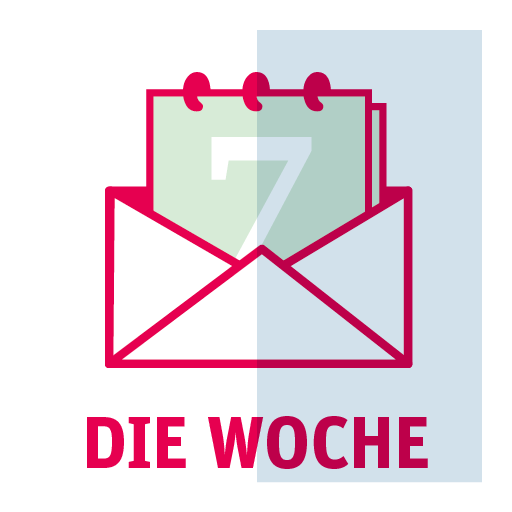
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Auch World Athletics kann diese Komplexität nicht leugnen, wie die Ausführungen dazu zeigen, wer denn nun genau in der weiblichen Kategorie antreten darf: a) »biologische Frauen«; b) trans Männer, wenn sie mindestens vier Jahre kein Testosteron mehr nehmen; c) »biologische Männer« mit vollständiger Androgenresistenz; sowie d) »biologische Männer mit einer abweichenden Geschlechtsentwicklung«, die Testosteronwerte unter 2,5 nmol/l Blut vorweisen. Das heißt, auch wenn ein SRY-Gentest positiv ist, könnte die betroffene Person für World Athletics nach einer »weiteren Beurteilung« dennoch als Frau gelten. Trans Frauen seien damit nicht gemeint, denn es würden momentan keine im Elitesport antreten. Sie wurden nämlich schon im März 2023 von World Athletics vom Frauensport ausgeschlossen, sofern sie eine männliche Pubertät durchlaufen haben.
Auswirkung weltweiter Angriffe
Der Verein Organisation Intersex International (OII), der sich für die Rechte intergeschlechtlicher Menschen einsetzt, wertet die vorausgegangene Entscheidung gegen trans Frauen und die neue Gentest-Regel als Auswirkung der derzeitigen weltweiten Angriffe auf die Menschenrechte von LGBTI-Personen, einschließlich des von US-Präsident Trump unterzeichneten Dekrets, alle trans Athletinnen vom Sport auszuschließen. OII weist darauf hin, dass Gentests im Sport keine neue Idee sind: Die IAAF hatte sie bereits in den 90er Jahren eingeführt und nach sieben Jahren wieder eingestellt. Bei den Olympischen Spielen 1992 und 1998 war es zu falschen positiven Ergebnissen gekommen und das Gen wurde bei intergeschlechtlichen Frauen gefunden. Auch die Aussage von Coe, es gehe darum, den Frauensport zu schützen, kritisiert der Verein: Es sei beschämend, dass ein machtvoller Elitesportverband wissenschaftliche Belege so selektiv heranziehen müsse, um zu entscheiden, wer als »echte« Frau zählt und wer nicht.
Schon 2009, anlässlich des Falles von Caster Semenya, stellte der*die Sexualwissenschaftler*in Heinz-Jürgen Voss zur Diskussion, ob die geschlechtsbedingten Unterschiede bei Bestleistungen nicht auch Ursachen der unterschiedlichen Lebens- und Trainingsbedingungen seien – und diese sich mit einer Beendigung der Diskriminierungen von Frauen und Mädchen auflösen würden. Für einzelne Disziplinen könnten auch statt Geschlecht andere wichtige Merkmale zur Einordnung herangezogen werden, so wie beim Ringen und Boxen das Körpergewicht, so Voss. Unabhängig davon, ob dieser Ansatz eine Lösung für fairen und inklusiven sportlichen Wettkampf sein kann – ein künstlicher Erhalt von binären Geschlechtskategorien durch Gentests oder Hormonanalysen scheint es aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu sein.
Dr. Isabelle Bartram ist Molekularbiologin und Mitarbeiterin beim Gen-ethischen Netzwerk e. V.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.






