Donald Trump: Griff nach der Macht per Zollpolitik
Trumps Handelskonflikte könnten auch das politische System der USA verändern

Trumps Zollpolitik beschäftigt nicht nur die Führung von Exportnationen. Die massiv erhöhten Zollgebühren bedeuten effektiv auch für die US-Wirtschaft die größte Abgabenerhöhung seit den 1950er Jahren. Das »Wall Street Journal« schätzt, dass 50 bis 60 Prozent der neuen Gebühren von US-Firmen getragen werden. Insgesamt werden sie sich nach Schätzungen in den kommenden zehn Jahren auf 3,9 Billionen Dollar oder fast ein Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes (BIP) summieren. Das ist weit mehr als etwa die Finanzierung der ausgeweiteten Krankenversicherung unter Präsident Barack Obama (0,4 Prozent des BIP), die von Republikanern auch mit Hinweis auf die Kosten heftig bekämpft worden war.
Dabei ist die Anti-Steuer-Lobby in den USA einflussreich: Denkfabriken wie das Liberty Justice Center, die Federalist Society oder die Handelskammern machen gegen die Zollpolitik mobil, die quasi einer Steuererhöhung im Inland gleichkommt. Doch im April unterließ es der US-Kongress, die eigenen Rechte der Legislative gegenüber dem Weißen Haus zu verteidigen, das die Zollerhöhungen unter Umgehung des Parlaments erlassen hatte. Bei einer Abstimmung im Senat scheiterte der letzte Versuch, Trumps Zollpolitik in die Quere zu kommen – dabei hatten auch republikanische Politiker Trump zuvor kritisiert, weil ihre Wähler stark steigende Preise durch die Importzölle befürchten. Der Druck aus dem Weißen Haus erwies sie schließlich als zu groß oder der Mut der Senatoren als zu gering.
Nun liegt es in den Händen des Obersten Gerichts zu entscheiden, ob Trump eine Steuer ohne Autorisierung des Kongresses erheben darf. Nachdem sieben von elf Richtern eines Berufungsgerichts Ende August den Präsidenten vorläufig zurückgepfiffen hatten, beginnt Anfang November die Anhörung in dem von zwölf Bundesstaaten angestrengten Verfahren. Trotz der Dominanz von republikanisch nominierten Richtern am Obersten Gericht ist das Ergebnis nicht vorhersehbar.
Ein ungewöhnlicher Offener Brief im Vorfeld zeigt, wie brisant diese Entscheidung sein wird: Libertäre und konservative Anwälte mahnen darin gemeinsam mit Liberalen an, dass eine Unterstützung des Gerichts für eine »Besteuerung durch bloße Proklamierung« des Präsidenten einen Verfassungsbruch darstelle, da das Recht zum Besteuern klar beim Kongress liegt». Eine Entscheidung für Trumps Zollpolitik würde willkürlicher Steuererhebung Tür und Tor öffnen, heißt es weiter. «Die Autorität, Steuern zu erheben, darf nicht wegen Unbeweglichkeit, Unaufmerksamkeit oder kreativer Rechtsinterpretationen still und leise in die Hände des Präsidenten gelangen.»
Dagegen behauptet US-Finanzminister Scott Bessent, dass die Stornierung von bereits erzielten Zolleinnahmen und die damit einhergehende Gefährdung von bereits ausgehandelten Handelsabkommen «katastrophal» wären. Trump selbst schreibt, eine Entscheidung gegen ihn würde eine «buchstäbliche Zerstörung» der USA darstellen und das Land «zu einer Dritte-Welt-Nation» degradieren.
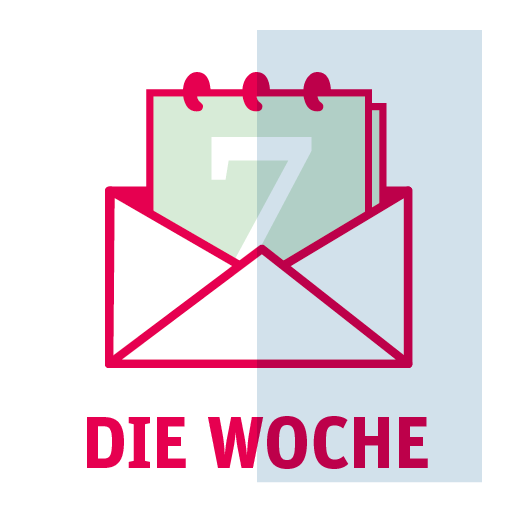
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Neben Verkäufern aus dem Ausland, die bezweifeln, ob sie überhaupt noch Waren in den USA absetzen können, machen sich auch Akteure in der US-Industrie Sorgen, ob sie unter den kommenden Bedingungen noch profitabel wirtschaften können. General Motors behauptet etwa, dass die höheren Zölle fünf Milliarden Dollar allein in diesem Jahr verschlingen würden. Zudem gehen die Lagerbestände aus der Zeit vor Trumps erratischer Zollpolitik zur Neige, und die Händler wissen oft nicht, zu welchen Konditionen sie bestellen oder auspreisen sollen.
Viele Firmen sind außerdem auf ausländische Maschinen angewiesen. Wenn Politiker zurzeit in Fabriken Reden über eine «Renaissance der amerikanischen Industrie» halten, wird ihnen oft hinterher in der Werkshalle gezeigt, dass die produzierenden Maschinen allesamt aus Europa oder Asien stammen. Solche Momente sind indes deutlich weniger medienwirksam als die Verhaftung von 300 südkoreanischen Schulungs-Mitarbeitern von Hyundai in Georgia durch die US-Einwanderungsbehörde. Ökonomen zufolge lässt sich die Globalisierung nicht einfach in einer Runde Zollerhöhungen ungeschehen machen, und sei diese noch so radikal.
Falls das Oberste Gericht in der Frage der Legitimität von Trumps Handelspolitik dem Weißen Haus grünes Licht gibt, würde dies Fragen nach einer grundsätzlichen Umorientierung der Gewaltenteilung im politischen System der USA aufwerfen – eine massiv gestärkte Exekutive könnte im Konfliktfall jede andere Institution übertrumpfen. Der Präsident hätte eine bisher unbekannte Machtfülle nicht nur über Staatsoberhäupter und Konzernchefs in der ganzen Welt, sondern auch über die Portemonnaies der eigenen Bürger.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.







