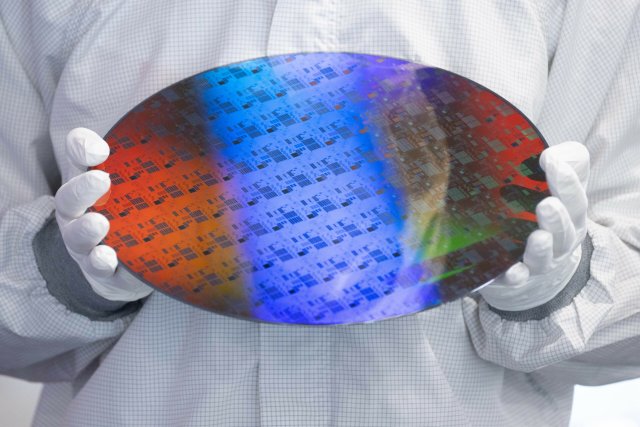- Wirtschaft und Umwelt
- Arzneimittel
Medikamentenversorgung in Europa weiter kritisch
Rechnungshof kritisiert nationale Alleingänge bei der Beschaffung und fordert mehr EU-Kompetenzen

Wie aus einem neuen Bericht des Europäischen Rechnungshofs (ECA) hervorgeht, erreichten die Medikamentenengpässe in der EU im vergangenen Jahr erneut einen Rekordwert und halten zum Teil auch in diesem Jahr noch an. »Das Problem drängt«, mahnte ECA-Mitglied Klaus-Heiner Lehne am Mittwoch bei der Vorstellung des Reports in Brüssel. »Es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden.« In der bevorstehenden Erkältungs- und Grippesaison sei mit einer Zunahme kritischer Engpässe zu rechnen. Als kritisch gilt der Mangel, wenn auf nationaler Ebene keine geeigneten Alternativen zu den fehlenden Arzneimitteln vorhanden sind.
Für die ohnehin stark belasteten Sozial- und Gesundheitssysteme in Europa bedeutet dies steigende Kosten aufgrund vermehrter Krankheitstage und teurerer Behandlungsmethoden. Auch für Patient*innen können die Folgen schwerwiegend sein. »Im Jahr 2024 führte ein Mangel an Arzneimitteln dazu, dass Patienten dauerhaft ihr Sehvermögen verloren«, erklärte Matthias Blaas, der im Rechnungshof für die Prüfung der EU-Gesundheitspolitik zuständig ist. Im Jahr 2022 erhielten Kinder aufgrund eines Engpasses beim Antibiotikum Amoxicillin andere Breitband-Antibiotika. Das könne zu Resistenzen führen und so die Wirkung verringern, heißt es im Bericht.
Abhängigkeit von Asien
Laut der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) liegt ein Grund für die kritischen Engpässe in der steigenden Nachfrage aufgrund des globalen Bevölkerungswachstums und der alternden Gesellschaft in Europa. Doch auch die Monopolbildung in der Pharmaindustrie sowie die Auslagerung der Arzneimittelproduktion führen zu Problemen. Aufgrund hoher Herstellungs- und Energiekosten in Europa haben Unternehmen ihre Produktion zunehmend nach China und Indien verlagert. Laut Rechnungshof ist die EU bei 70 Prozent ihrer pharmazeutischen Wirkstoffe und 79 Prozent ihrer Arzneimittel-Vorläufersubstanzen auf Länder in Asien angewiesen.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die EU-Kommission in diesem Jahr eine Industriepolitik für die pharmazeutische Industrie vorgeschlagen. Ob Subventionen als Anreize für Standorte in Europa dazu zählen sollten, wollten die Prüfer nicht beantworten und verwiesen auf Parlament sowie Kommission. »Das stünde aber nicht im Widerspruch zu unseren Befunden«, ergänzte Lehne auf »nd«-Nachfrage. Zudem sollte sich die öffentliche Beschaffung von Arzneimitteln nicht an den niedrigsten Preisen, sondern an Qualität und Versorgungssicherheit orientieren.
Aus Sicht der Prüfer*innen könnte auch eine verstärkte EU-Koordination bei der Beschaffung helfen. Die Mitgliedstaaten reagieren auf Engpässe vielfach mit nationalen Alleingängen. So haben beispielsweise Griechenland, die Slowakei und Bulgarien Ausfuhrverbote für bestimmte Arzneimittel verhängt. Andere Länder wie Frankreich konzentrieren sich auf die Rückverlagerung der Industrieproduktion ins eigene Land oder auf Bevorratungsquoten. Das begünstigt wiederum Engpässe in anderen Ländern.
Fragmentierter EU-Markt
Der Handel innerhalb des europäischen Binnenmarktes ist kostspielig und komplex. Unterschiede bei Arzneimittelbezeichnungen, Packungsgrößen und Kennzeichnungsvorschriften sorgen dafür, dass der Markt fragmentiert bleibt. Geringe Preistransparenz und erhebliche Kostenunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten verschärfen die Situation zusätzlich.
Laut Prüfer*innen ist die Veröffentlichung einer EU-weiten Liste von derzeit 268 kritischen Arzneimitteln durch die Kommission ein wichtiger Schritt hin zu mehr Koordination auf europäischer Ebene. Das Ziel besteht darin, die europäische Produktion dieser Medikamente gezielt zu stärken und strategische Partnerschaften, auch mit Drittstaaten, aufzubauen.
Insgesamt sei die Reaktion der EU-Kommission jedoch zu langsam, wird im Bericht bemängelt. Zwar sei die neue Europäische Plattform zur Überwachung von Engpässen wichtig, doch sie sei weiterhin nicht voll funktionsfähig. Zudem fehle es der EMA an den nötigen Kompetenzen, um die Mitgliedstaaten auch außerhalb von Gesundheitskrisen zu unterstützen. Dadurch gebe es nur wenige belastbare, vergleichbare und zeitnahe Informationen über die Verfügbarkeit von Medikamenten. Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Engpassmeldungen der vergangenen zwei Jahre erfolgte nicht vor, sondern erst am oder nach dem Auftreten des Mangels.
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.