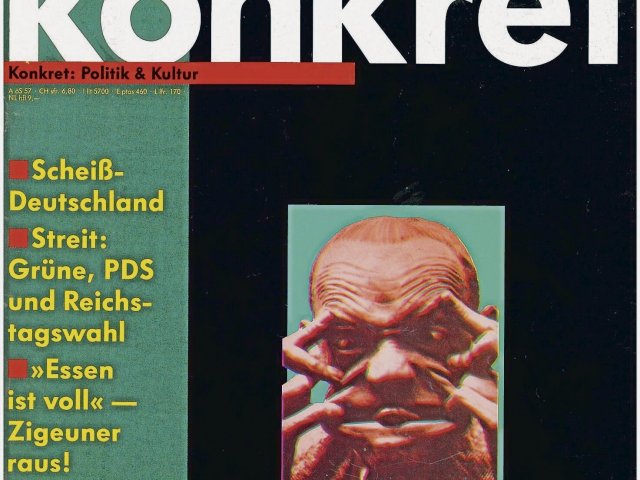- Kultur
- »Marx als Demokrat«
Demokratie und das Ende der Politik
Auszug aus Alex Demirovićs Buch »Marx als Demokrat« (Verlag Dietz Berlin)

Wie kann man sich also auf die Überlegungen von Marx zu Fragen der Demokratie beziehen? In den folgenden Ausführungen zu demokratietheoretischen und -politischen Betrachtungen und Bemerkungen von Marx soll die These vertreten werden, dass sich in seinen Texten bemerkenswerte Hinweise und Ansätze zu einer Kritik des besonderen, eigensinnigen Bereichs der Politik, des Staates und der Demokratie finden. Er hat sich kritisch zur spezifischen Logik des Politischen und der Demokratie geäußert. Diese Logik kennzeichnet den autonomen Bereich der politischen Demokratie und ist konstitutiv für die kapitalistische Produktionsweise. Damit will ich sagen: Demokratie steht dem Kapitalismus nicht entgegen, ist nicht das Andere des Kapitalismus, sondern ist im idealen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise erforderlich, damit kapitalistische Akkumulation gelingen kann. Dies ist die materielle Grundlage dafür, dass Demokratie, Volkssouveränität, Repräsentation, Gewaltenteilung immer wieder konkrete Formen von bürgerlicher Herrschaft sind und vom Bürgertum selbst als normativer Maßstab für die kritische Beurteilung kapitalistischer Verhältnisse herangezogen werden. Auch wenn die realen Staaten autoritär beherrscht werden, ist die Norm gleichsam immer schon da.
Die Sphäre der Politik und der Demokratie ist keine der Freiheit, wie das etwa von Hannah Arendt nahegelegt wird.
Marx hat jedoch weder eine umfassende Theorie der kapitalistischen Produktionsweise in ihrer Gesamtheit dargelegt, noch hat er eine Kritik der politischen Kategorien ausgearbeitet, allenfalls finden sich Beobachtungen, Stichwörter, Hinweise auf sein Grundverständnis. Das entspricht seinem Vorgehen, das er auch für die kritische Analyse der politischen Ökonomie entwickelt hat: Zur Analyse der inneren Organisation der kapitalistischen Produktionsweise gelangt Marx durch die Kritik der objektiven Kategorien, der ideologischen Formen, der alltagsreligiösen Überzeugungen, in denen die sozialen Gruppen und Individuen praktisch und intellektuell aktiv sind. Die Logik dieses idealen Durchschnitts ist für die Akteure nicht zu umgehen. Auch in diesem Fall gilt, dass die Menschen frei handeln, aber nicht unter selbst gewählten Verhältnissen.
Die Sphäre der Politik und der Demokratie ist keine Sphäre der Freiheit, wie das etwa von Hannah Arendt nahegelegt wird. Aber sie ist auch nicht einfach von ökonomischen Zwängen determiniert. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, ja, aber je spezifische Handlungszwänge und Freiheiten existieren sowohl in der Politik, der Ökonomie oder der Kultur. Es muss unterstrichen werden: Auch in der Ökonomie gibt es die Freiheiten der Klassenpraktiken: Unternehmer entscheiden über Investitionen oder engagieren sich in Wirtschaftsverbänden, um kollektiv auf gesellschaftliche Prozesse einzuwirken und ihre Macht und Herrschaft zu erhalten; Arbeiter organisieren sich in Gewerkschaften und kämpfen für höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und mal weniger, mal mehr gegen Ausbeutung und für gesellschaftliche Alternativen.
Es gilt aber auch: Die Überbauten kennen nicht nur Freiheit, sondern auch ihre eigenen formspezifischen Notwendigkeiten. Dazu gehört, dass die Sphäre der Politik durch den Maßstab des Allgemeinwohls, durch das Prinzip des politischen und rechtlichen Willens, durch Parteibildung oder Repräsentation bestimmt ist. Der Wille ist konstitutiv für das imaginäre Verhältnis der politischen Subjekte zu sich selbst: Objektive Prozesse werden dem Handeln der Individuen zugerechnet; diese müssen glauben, dass sie sich frei entscheiden können und frei ihrem Willen folgen.
Es gibt eine bedeutende Formulierung, in der Marx die Ergebnisse seiner Forschungen rekapituliert. Demnach erlangen die Menschen in den ideologischen Formen von Politik, Moral, Recht oder Kunst das Bewusstsein des Gegensatzes zwischen dem Reichtum ihrer kooperativen Beziehungen und den bisherigen Produktionsverhältnissen, die deren Entfaltung begrenzen und Einzelnen erlauben, den Reichtum der gemeinsamen Arbeit für ihre Zwecke anzueignen. In diesen Überbauten tragen die Menschen, Marx zufolge, diese Konflikte auch aus. Das ist eine theoretische und methodische Überlegung von großer Tragweite. Denn damit sagt Marx, dass die Überbauten keine Sphäre der Passivität sind, in denen sich die materiell-ökonomischen Verhältnisse lediglich abbilden, widerspiegeln oder ausdrücken. Das Sein materialisiert sich hier in besonderen Formen des Bewusstseins, in der Sprache des täglichen Lebens, in der die Menschen sich mit anderen verständigen und koordinieren, in den Widersprüchen und Kämpfen.
Die Überbauten stellen Formen dar, in denen Menschen auf spezifische Weise aktiv werden, frei handeln, über die gesellschaftlichen Entwicklungen streiten und die Entscheidungen über ihre gemeinsamen Zukünfte treffen. Politik, Staat, Recht sind dabei für Marx kein privilegierter Überbau, kein Zentrum der Gesellschaft, nicht das übergeordnete Allgemeine, sondern einer unter mehreren Überbauten. Denn das politischstaatlich Allgemeine ist das Allgemeine einer besonderen Klasse. Die Überbauten unterscheiden sich danach, wie in ihnen als besonderen Formen der Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen bewusst wird und auf welche Weise er der Logik der jeweiligen Sphäre nach ausgetragen wird. Zusammen bilden sie das vielfach gegliederte organische Ganze der kapitalistischen Produktionsweise.
Es geht darum, die inneren Grenzen der bürgerlichen Demokratie selbst zu überwinden.
Im Folgenden geht es mir darum, einige wesentliche Elemente aus den Texten von Marx zusammenzutragen, in denen er über die eigensinnige Logik der Politik und der Demokratie nachdenkt. Dabei drängt sich mir der Eindruck auf, dass der junge Marx ein radikaler Demokrat war, der sich leidenschaftlich für eine öffentliche Willensbildung, die Republik und die parlamentarische Demokratie eingesetzt hat, eine wirkliche politische Allgemeinheit. Allerdings hat er auch schon sehr schnell die Unzulänglichkeiten und Selbstwidersprüche der politischen Demokratie erkannt. Vom Verlauf der Revolution 1848 und den darauffolgenden konterrevolutionären Entwicklungen sah er sich in seiner Kritik bestätigt.
Demokratische Prozesse können sich demnach nicht aus sich selbst heraus, aus dem guten Willen, aus demokratischen Einstellungen und Bekenntnissen oder der Berufung auf die Vernunftnormen der Französischen Revolution wie Gleichheit und Freiheit konstituieren. Praktiken der Demokratie – Wahlen, Parlamente, demokratische Verfahren, freie Presse, intellektuelle Deutungen und Theoriebildungen oder alltägliche Überzeugungen und Einstellungen – stellen in sich konkrete Kräfteverhältnisse dar, die mit weiteren Verhältnissen verbunden sind. Es wäre ein Missverständnis, diese nur in der Ökonomie zu suchen. Diese soll ja selbst genossenschaftlich organisiert, also demokratisiert werden. Es geht also darum, die Demokratie von ihrer quasi-religiösen Form zu emanzipieren, ihren rationalen Gehalt zur Geltung zu bringen und damit die inneren Grenzen der bürgerlichen Demokratie selbst zu überwinden.
Es lässt sich durchaus davon sprechen, dass das Werk von Marx durch verschiedene Phasen gekennzeichnet ist: eine frühe, philosophisch-humanistische Phase von 1842 bis 1844, und ab 1845 mit den Texten zur sogenannten »Deutschen Ideologie« und danach die Phase, in der Marx ein wissenschaftliches Programm verfolgt hat, mit dem er an einer Kritik der politischen Ökonomie arbeitete. Seine Theorie, so Althusser, sei vor allem im »Kapital« enthalten. Das ist eine grobe Einteilung. Es ist wohl genauer, nicht so sehr von einem Bruch als von mehreren Einschnitten und Verschiebungen zu sprechen. (…)
Berücksichtigen wir diesen Aspekt der Arbeiten von Marx, dann können wir grob sechs Phasen unterscheiden. In der Zeit bis 1844/45 war Marx intensiv mit demokratietheoretischen Fragen befasst; ich möchte die Werke dieser Zeit in zwei Phasen unterscheiden. Für die Zeit danach können vier weitere Phasen unterschieden werden. Das Thema der Demokratie wird als Moment von Klassenherrschaft und gesellschaftlicher Arbeitsteilung bestimmt (3. Phase). Es gewinnt wieder an Bedeutung mit der europäischen Revolution von 1848, den zögerlichen Bemühungen um eine parlamentarische Demokratie in Deutschland, dem Staatsstreich von Louis Bonaparte am 2. Dezember 1851 und den Erfahrungen mit dem Parlamentarismus in England (4. Phase). In den Arbeiten zur Kritik der politischen Ökonomie, die vor allem seit Ende der 1850er Jahre entstehen, versucht Marx, den Nachweis zu führen, dass eine demokratische Alltagsreligion unerlässlich für die Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse ist (5. Phase). Die Pariser Kommune veranlasst Marx dann schließlich dazu, über positive Modelle der Demokratie nachzudenken (6. Phase). Die Phasen dauern unterschiedlich lang und verlaufen teilweise sehr dynamisch:
- 1842–1843: die Phase der radikalen Demokratie- und Öffentlichkeitstheorie.
- 1843–1844: die Phase der Kritik der Politik.
- 1845–1848: die Phase der Entdeckung und Kritik der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Klassenherrschaft.
- 1848 ff.: die Phase der Kritik am Versagen der demokratischen Politik des Bürgertums.
- 1857–1871: die Phase des Nachweises, dass Demokratie konstitutiv ist für das Kapitalverhältnis.
- 1871 ff.: die Phase der Suche nach alternativen Formen der assoziierten Koordination der Gesellschaft.
Bemerkenswert ist, dass Marx viele Argumente aus jeweils früheren Phasen nicht völlig aufgibt, sondern versucht, sie in den Kontext seiner fortentwickelten Theorie einzubauen. Er nutzt sie, weil sie etwas zum Verständnis der Verhältnisse beitragen, aber auch, um damit Sachverhalte aufzuklären und ihr rationales Moment herauszuarbeiten. Das gilt etwa für seine kritischen Überlegungen zur Religion, weil sich ansonsten der mystische, spukhafte Charakter von Kapital und Demokratie als Formen säkularisierter Religion gar nicht verstehen lässt; seine Kritik an Politik, Freiheit und Gleichheit; seine Modifikationen an der sozialen Differenzierung von Ökonomie und Politik; seine Überlegungen zu rationalen Formen der Koordination als Ersatz für den bürgerlichen Staat.
Alex Demirović (1952) ist Gesellschaftswissenschaftler. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags Dietz Berlin.
Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Dank der Unterstützung unserer Community können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen
Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.