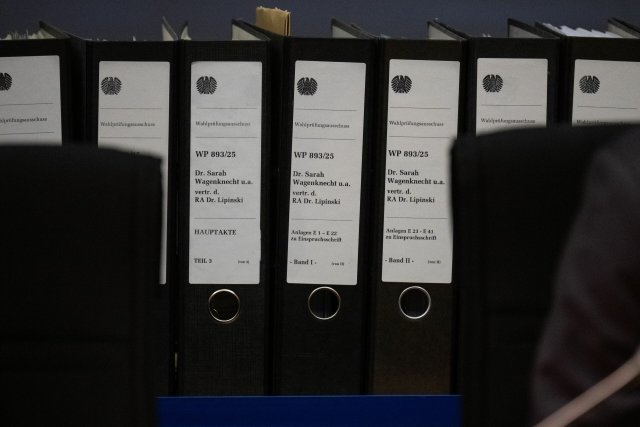- Politik
- Massenproteste
Brasilien: Kein Pardon für Banditen
Massenproteste in Brasilien gegen die Ausweitung der Immunität für Politiker und eine Amnestie für Bolsonaro

Viele Zehntausende sind am Sonntag in Brasilien auf die Straße gegangen, um gegen Reformpläne der konservativen und rechten Mehrheit im Parlament zu protestieren. Die Proteste richten sich gegen ein Gesetzesvorhaben zur Erweiterung der Immunität der Abgeordneten, mit dem diese sich stärker gegen eine Strafverfolgung durch die Justiz abschirmen wollen. Zugleich wurde gegen eine im Kongress angestrebte Amnestie für die Beteiligten am Versuch eines Staatsstreiches demonstriert.
In einem historischen Urteil hatte das Oberste Gericht vor wenigen Tagen Ex-Präsident Jair Bolsonaro schuldig gesprochen, 2022 an der Spitze eines Komplotts für einen Putsch gegen seinen gewählten Nachfolger Lula da Silva von der linken Arbeiterpartei (PT) gestanden zu haben. Bolsonaro ist zu 27 Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.
In mehr als 50 Städten fanden Demonstrationen unter Losungen wie »Keine Amnestie« und »Nein zum Gesetz des Banditentums« statt. Auch im Ausland lebende Brasilianer führten am Protesttag etliche Kundgebungen durch, darunter war auch eine vor der Botschaft ihres Landes in Berlin. Aufgerufen hatten linke Parteien und soziale Bewegungen, auch zahlreiche Künstler beteiligten sich an den Aktionen, darunter die Musiker Caetano Veloso, Gilberto Gil und Chico Buarque, die an Rios Copacabana auf einer Kundgebung mit mehr als 40 000 Menschen auftraten.
Auch in São Paulo hatten sich Zehntausende versammelt. Von der Menge wurde eine riesige brasilianische Fahne durch die Avenida Paulista getragen – als Symbol für die Souveränität des Landes, nachdem US-Präsident Donald Trump wegen des Prozesses gegen Bolsonaro Strafzölle erlassen und weitere Drohungen ausgesprochen hatte. Entsprechend ist das nordamerikanische Sternenbanner in Brasilien das Symbol der Bolsonaristen.
Das in Brasilien für höhere Amtspersonen vorhandene Privileg, ausschließlich von den oberen Instanzen der Gerichte verurteilt werden zu können, würde mit der Änderung des Artikels 53 der Verfassung auf straf- und zivilrechtliche Fälle ohne Bezug zur Abgeordnetentätigkeit und Chefs der im Kongress vertretenen Parteien erweitert werden. Ohne Genehmigung der Legislative dürfen dann Strafverfahren gegen Abgeordnete oder Senatoren vom Obersten Gericht nicht eröffnet werden. Abstimmungen über die Aufhebung der Immunität und die Genehmigung von erfolgten Verhaftungen sollen künftig geheim erfolgen.
Die am Dienstag vom Repräsentantenhaus in zweiter Lesung beschlossene Novelle muss nun erst noch den Senat passieren. Das aber ist im Oberhaus – auch angesichts der großen öffentlichen Empörung – nicht garantiert. Die Abgeordneten stimmten anschließend auch für einen Erlass der Strafen für die am Sturm auf den Kongress in Brasília im Januar 2023 beteiligten Bolsonaro-Anhänger. Im Falle einer Amnestie, die Bolsonaro selbst und den mit ihm verurteilten Politikern und Militärs zugutekäme, hat Präsident Lula bereits angekündigt, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen.
Für den neuen Arbeiterpartei-Vorsitzenden Edinho Silva sind die großen Proteste vom Sonntag gegen das sogenannte Abschirmgesetz für Parlamentarier ein deutliches Signal an die Politik und besonders den Nationalkongress. Die Kundgebungen in ganz Brasilien hätten die Mehrheitsmeinung und »die Empörung im brasilianischen Volk sichtbar gemacht«, erklärte der Politiker.
Für die rechten Kräfte geht es nach der Verurteilung von Bolsonaro um einen symbolträchtigen Machtkampf mit der Judikative. In den Augen vieler Brasilianer wollen die schon traditionell mit einer hohen Kriminalitätsrate in allen Sparten belasteten Volksvertreter mit dem Gesetz zudem die Zeit zurückdrehen.
Erst 2001 und nach zahlreichen Skandalen um in Drogenhandel, Korruption und sogar Morde verstrickte Politiker und langen öffentlichen Protesten erlaubte es eine Verfassungsänderung dem Obersten Gericht, Untersuchungen gegen Parlamentarier ohne die Zustimmung des Unterhauses oder Senats einzuleiten.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.