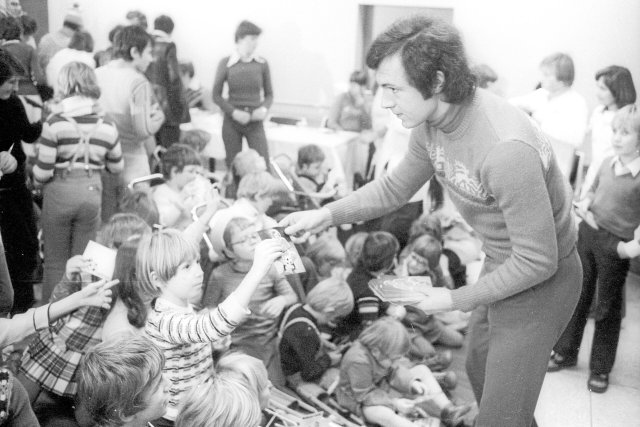- Kultur
- Männlichkeitskritik
Heult doch!
»Toxische Männlichkeit« unterstellt, dass Männer keine Emotionen zeigen dürfen. Aber stimmt das überhaupt?

Männer sollen ihre Gefühle zeigen! Diese Forderung dominiert seit einigen Jahren die gesellschaftliche Debatte um Männlichkeit. Das ist zunächst einmal deshalb irritierend, weil Männer im Allgemeinen keine so großen Probleme zu haben scheinen, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen: Beim Herrenfußball der Bundesliga liegen sich Männer regelmäßig in den Armen und vergießen Tränen der Trauer oder Freude. Dass auch Wut und Hassbekundungen in der Öffentlichkeit eher Männersachen sind, beweisen Wutausbrüche im Straßenverkehr und Shitstorms auf Social Media. Betroffene von sexueller Belästigung durch johlende Männergruppen auf der Straße, von Wutanfällen der Chefs im Büro oder der Partner im eigenen Zuhause wären wahrscheinlich heilfroh, wenn Männer ihre Gefühle etwas weniger zeigen würden.
Verfechter*innen der männlichen Gefühlsbefreiung würden diesem Widerspruch zwischen dem Bild und der Realität von Männlichkeit begegnen, dass diese negativen Ausbrüche nur Folgen der Unterdrückung von Emotionen sind. Spätestens seit den Debatten um »toxische Männlichkeit« ist es üblich, die emotionale Zurichtung von Männern als den hauptsächlichen Ursprung verschiedenster Missstände zu sehen, etwa die hohe Rate an Depression und Suiziden von Männern oder ihre Täterschaft bei körperlicher und vor allem sexualisierter Gewalt und Dominanz. Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz, dass emotional unausgeglichene Männer schnell zur Belastung für sich und andere werden. Sprüche wie »Männer machen einen Podcast, statt in Therapie zu gehen« und dessen tausende auf Social Media geteilten Varianten zeugen davon.
Patriarchale Funktion der Härte
Das ist nicht ganz falsch – aber meist nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn die Einsicht, dass gegen sich selbst gerichtete Härte oft auch zu Härte gegen andere führt und diese legitimieren kann, bleibt oft viel zu allgemein. Dadurch wird die patriarchale Funktion dieser Härte zum Verschwinden gebracht. Die vermeintlich kritische Thematisierung von Männlichkeit und Gefühlen kann so sogar männliche Macht verschleiern und zementieren, statt diese abzubauen.
Ein Paradebeispiel für diese Argumentation ist ein Interview mit Mithu M. Sanyal im »Fluter – Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung« zu feministischen Kämpfen. In diesem lobt die Autorin »eine tolle Definition«, nach der »die Gefühle von Männern« im Patriarchat »unterbewertet werden«: »Wenn du Jungs abtrainierst, Empathie für sich selbst zu haben, wie sollen sie Empathie für ihre Freundinnen haben?« Aus Sanyals Sichtweise spricht ein liberaler Feminismus, der das Patriarchat vor allem als ein Bündel von kulturellen Rollenvorstellungen begreift, die »uns alle« einschränken. Und deshalb könnte man sie relativ harmonisch »gemeinsam« überwinden.
Männer kommen hier auch als Betroffene des Patriarchats in den Fokus und ihre Dominanz wird aus einer Art Defizit-Perspektive erklärt. Wenn Männer schädlich handeln, dann, weil ihnen etwas fehlt, weil sie etwas nicht können, weil die Gesellschaft etwas in ihnen unterdrückt. Dabei hat doch feministische Herrschaftskritik eigentlich immer auf das Gegenteil verwiesen: Männer handeln unterdrückerisch, weil es ihnen etwas bringt, weil sie damit etwas wollen, weil das Patriarchat sie dazu ermächtigt. Kein Wunder also, dass diese Defizit-Perspektive männliche Gewalt auch verharmlosen kann, statt diese aufzuklären.
Männern sind ihre Anliegen, ihre Wahrnehmung und ja, auch ihre Gefühle meist wichtiger als die ihrer Mitmenschen – besonders Frauen.
Daniel Holtermann, Co-Autor*in des Ratgebers »Männlichkeit (Ver)lernen«, erklärte Femizide in einem Podcast aus der emotionalen Unselbstständigkeit von Hetero-Männern. Nach einer Trennung etwa sei »der cis Mann dann nicht mehr in der Lage, für seine eigene Beziehung zu sorgen, für sich selbst zu sorgen«. Er sei »in so einer Not, dass er zu Gewalt nach außen greift«. Um diese Taten zu verhindern, müsse deshalb für mehr Sensibilität bei Männern gesorgt werden. Der Femizid als Mord aus misogynem Hass und männlichem Anspruchsdenken, der meistens am Ende einer langen Geschichte von Kontrolle und Beziehungsgewalt steht, gerät so aus dem Blick. Übrig bleibt, wie so oft, die Not des Mannes – auch wenn er für diese hier selbst verantwortlich gemacht wird. Spätestens wenn »Männer bringen Frauen um, statt in Therapie zu gehen« quasi als ernsthafte Position präsentiert wird, sollte Schluss mit lustig sein.
Missstände wie ungleich verteilte Beziehungsarbeit werden von dieser Art Männerversteherei also durchaus problematisiert. Aber sie werden nur über eine Umleitung angegangen: Statt bei der Ungleichheit und Dominanz anzufangen und dann auf die Rolle von Gefühlen darin zu blicken, soll sich die Herrschaft über die Beschäftigung mit Gefühlen fast wie von allein auflösen. Würde man die Kritik an der patriarchalen Herrschaft ansetzen, müssten die beklagten Normen im Kontext ihrer Funktion betrachtet werden. Die männliche Geschlechterrolle besteht daraus, keine emotionale Sorge für sich und andere zu übernehmen und alles zu vermeiden, was unkontrollierbare Schwäche oder Abhängigkeit bedeuten könnte. So weit stimmt das. Doch daraus folgt nicht, dass Männer Gefühle allgemein unterdrücken und noch weniger, dass sie ihre Gefühle nicht ernst nehmen. Im Gegenteil: Männern sind ihre Anliegen, ihre Wahrnehmung und ja, auch ihre Gefühle meist wichtiger als die ihrer Mitmenschen – besonders Frauen. Und sie sind im Zweifel oft bereit, das Wohlbefinden, die Würde und sogar die Unversehrtheit anderer zu opfern, um daran festzuhalten.
Der für diese Durchsetzungsfähigkeit nötige Drill ist zwar zweifellos auch dehumanisierend für die Männer selbst. Aber es ist schlicht der Preis für ihre geschlechtlich-gesellschaftlichen Herrschaftsansprüche sowie für die Fähigkeit, diese relativ rücksichtslos gegen sich und vor allem andere durchzusetzen. Deshalb sehen Männer in der Regel gar nicht die Notwendigkeit, sich um sich und ihre Gefühle zu sorgen: Weil sie damit aufwachsen, dass sie diese Gefühle zum Problem von anderen machen können – und dürfen.
Erwartete Fürsorge
Dass Männer nur einer ausgeglichenen Persönlichkeit bedürften, um von Herrschaftsansprüchen abzulassen oder sie »nicht mehr nötig zu haben«, ist eine pseudo-therapeutische Scheinlösung angesichts der politischen Ideologie von Männlichkeit, die bis in das Privateste vordringt. Der Autor dieses Textes ist ein gutes Beispiel dafür: Vor meiner Psychotherapie war ich ein Mann, der nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen, und der dann erwartete, dass Frauen sich darum kümmern. Danach war ich ein Mann, der benennen konnte, was er empfand, und dann erwartete, dass Frauen sich darum kümmern – jetzt sogar noch mehr, weil ich doch so offen und ehrlich kommuniziert habe!
Insofern können tatsächlich auch progressive Frauen – oder gar insbesondere diese – ein Lied davon singen, dass Männer, die sich selbst für empathisch, sensitiv oder sogar feministisch halten, manchmal die Schlimmsten sind. Das liegt daran, dass das grundlegende Problem ihrer von Herrschaft geprägten Emotions- und Begehrensstruktur nicht wirklich verändert, sondern eher verschleiert wird. Da die Herrschaftsansprüche stets nachgelagert werden, lautet die versteckte Frage hinter einer solchen »kritischen Männlichkeit« allzu oft: »Wie kann ich lernen, gut mit anderen, insbesondere Frauen, zu kommunizieren und gleichzeitig daran festhalten, dass Sie mir nichts zu sagen haben?« So setzt sich immer weiter ein Bezug zu sich selbst und anderen durch, den die feministische Sozialpsychologin Jessica Benjamin als »abstrakte Differenzierung« beschreibt: Die Bedürfnisse oder Gefühle von anderen werden nicht lebendig in Beziehung erlebt, sondern als abstrakte Anforderungen, die man, wenn man(n) sie überhaupt achtet, nur »bearbeiten« muss.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Es geht den Männern also um sich selbst. Viele kennen das aus der modernen Sexualkultur. Männer sind nun öfter darauf aus, dass Frauen beim Sex mit ihnen einen Orgasmus haben. Aber nicht aus Interesse an der aktiven Lust von Frauen, sondern weil sie um ihr Selbstbild als »gute Liebhaber« bemüht sind. Was Benjamin beschreibt, ist keine schlichte Unfähigkeit. Es ist eine bis tief ins Unbewusste verankerte Einstellung, ja sogar allgemeine Beziehungs-Wahrnehmung mit Herrschaftsfunktion: einerseits selbst als Mann immer souverän bleiben und andererseits Frauen als autonome Subjekte verneinen. Wird das Grundproblem von patriarchaler Herrschaft sekundär gesetzt, kann also noch jede (pseudo-)therapeutische Gefühlsbefreiung zur »Technik« werden, mit der Männer weiter andere als eigenständiges Gegenüber negieren.
Ironischerweise könnte Mann gerade in der Konfrontation mit diesen Zuständen in sich, anderen Männern und der patriarchalen Gesellschaft auf eine ganze Reihe an verdrängten Emotionen stoßen. Diese aber sind bezeichnenderweise nur selten gemeint, wenn mal wieder gefordert wird, dass Männer »Gefühle an sich ran lassen« oder über sie reden sollen: Angst vor Souveränitätsverlust, Wut auf Weiblichkeit, Hass auf Schwäche. Vor allem aber fehlendes Mit-Gefühl für Frauen und Queers, deren Leiden allein scheinbar nie ausreicht, um leidenschaftlich etwas an sich selbst und dem Patriarchat ändern zu wollen.
Kim Posster lebt in Leipzig und publiziert seit mehreren Jahren zur (praktischen) Kritik an Männlichkeit. Sein aktuelles Buch »Männlichkeit verraten! Über das Elend der ›Kritischen Männlichkeit‹ und eine Alternative zum heutigen Profeminismus« erschien 2023 im Neofelis Verlag (112 S., br., 12 €).
Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen
Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.