- Politik
- DDR und BRD
Wiedervereinigung: Unmenschlicher Übergang
Der damalige Korrespondent der italienischen Tageszeitung »Il Manifesto« beschreibt seine Eindrücke aus den Jahren 1989/90

Ich verfolgte die Entwicklungen in der DDR mit großem Interesse aus der Redaktion der Zeitung »Il Manifesto« in Rom – einem Zentrum engagierten Journalismus’ mit einem besonderen Augenmerk auf die Veränderungen im Osten. Unsere Korrespondenten aus Moskau – Astrit Dakli – und aus Bonn – Guido Ambrosino – sagten mir, dass es Zeit sei aufzubrechen, notwendig, »die Wende« zu dokumentieren. Die geschätzten Kollegen hatten das Gefühl, dass bald etwas Neues geschehen würde, und ich durfte nicht fehlen.
Getrieben von Neugier und Instinkt, nahm ich in den ersten Oktobertagen 1989 einen Nachtzug von Mailand Richtung München. Am späten Vormittag stieg ich in einen ziemlich altmodischen Zug um, der in »die Zone« fuhr – Ziel: Ost-Berlin. Dann kam der 9. November – ein Tag, der in die Geschichte eingehen sollte. Ich war ursprünglich für einen Monat nach Berlin gekommen – und blieb ein ganzes Jahr.
Am 3. Oktober 1990 wurde Berlin wiedervereint. Außer den offiziellen Feiern in der Nähe des Reichstags fanden auch Veranstaltungen von Gegnern einer schnellen Wiedervereinigung statt. Im Stadtteil Kreuzberg versammelten sich die Gruppen der alternativen Linken, die eine »dritte Option« befürworteten – eine Idee, die auch von Intellektuellen aus Ost-Berlin wie Christa Wolf vertreten wurde.
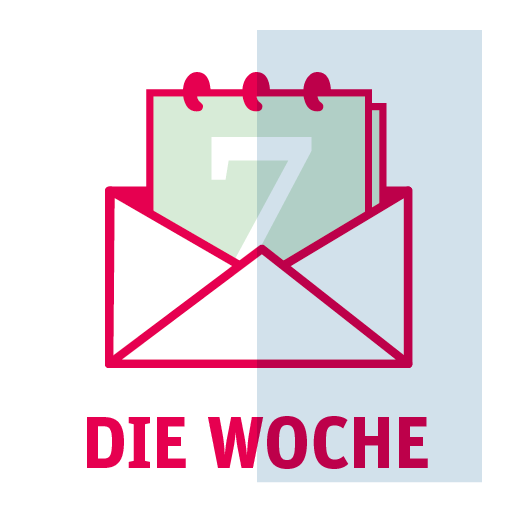
Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Am aktivsten beim Protest gegen die Wiedervereinigung waren die Gruppen der »Autonomen«, die mit den besetzten Häusern verbunden waren, sowie alle »Alternativen« aus Ost und West, die in der starken D-Mark ein Vorzeichen für ein Big Game, eine regelrechte Annexion sahen – eine Entwicklung, die enorme soziale Verwerfungen unter den Bürgern der DDR hervorrufen würde, die es gewohnt waren, in einem System zu leben, das ihnen alles garantierte.
Und tatsächlich wurden bereits in den ersten Monaten des Jahres 1990 die Auswirkungen des Wandels deutlich. Weite Produktionsbereiche im Osten – von den Großfabriken bis zu den Bergwerken – wurden stillgelegt, »abgewickelt«. Millionen von Arbeitern verloren ihre Jobs und lebten fortan von Arbeitslosengeld. Viele andere zogen in westdeutsche Städte, auf der Suche nach Arbeit und einem neuen Leben – basierend auf den Maßstäben der neuen Religion, des Marktes.
Ich beschloss, die DDR zu entdecken: Nach langen Gesprächen mit dem Pressesprecher des Informationsministeriums gelang es mir, eine seltene Akkreditierung für ausländische Korrespondenten zu erhalten. Sicherlich trug es zum Vertrauen bei, dass ich für die Redaktion einer kommunistischen Zeitung arbeitete. Gemeinsam mit der jungen Dolmetscherin Uta plante ich einige Reisen in die Industriegebiete der DDR.
Für die rund 250 Kilometer von Berlin nach Sangerhausen brauchten wir einen ganzen Tag. Wir reisten in einem alten Trabant. In der Nähe von Bitterfeld trafen wir auf einen Kontrollposten der Sowjetarmee. Die Soldaten forderten auf Russisch unsere Papiere und den Passierschein. Es schien fast, als hätten sie auf uns gewartet …
Im Frühjahr 1990 hatte ich erneut eine persönliche Begegnung mit sowjetischen Soldaten. Auf dem Weg in die KZ-Gedenkstätte Buchenwald traf ich am Bahnhof Weimar auf viele Rotarmisten: »Wir fahren nach Hause und warten auf den Zug«, sagte einer von ihnen. Erst später erfuhr ich, dass diese Soldaten keine Heimat mehr hatten: In der Sowjetunion gab es nicht genügend Kasernen, keine Wohnungen, kein Geld, um sie zu entlohnen. Sie waren nutzlos geworden.

In Sangerhausen sollten wir die ersten Ausländer sein, die eine Gruppe von Bergleuten begleiten. Am Abend, in einer Art »Staatstrattoria«, bestellten wir Brot, Salami und Essiggurken – die einzigen verfügbaren Lebensmittel. Am nächsten Morgen, als wir am Tor der Thomas-Müntzer-Mine eintrafen, empfing uns der Direktor mit sichtlicher Rührung. Mit Stolz erzählte er die Geschichte des Bergwerks und der Generationen, die in diesen Stollen gearbeitet hatten – sie waren der Produktionsstolz der DDR. Mit dem Aufzug tauchten wir ein in eine fremde Welt. Noch nie war ein Journalist hier unten gewesen.
Im Frühjahr 1990 hatten jene, die im wirtschaftlichen Bereich Entscheidungen trafen und dabei an das große Deutschland dachten, bereits die Schließung der Stollen des Bergwerks »Thomas-Münzer« in Sangerhausen beschlossen – aber den Arbeitern hatte man nichts gesagt. Innerhalb von zwei Monaten kam es zur Schließung aller Produktionseinheiten, da sie als nicht mehr den europäischen Standards entsprechend galten. Die Arbeiter in Schwer- und Rohstoffindustrie nahmen die Entscheidung hin, ohne sich zu wehren – schockiert wie nach einem Erdbeben. Viele ertränkten die bittere Enttäuschung im Alkohol. Sie blieben ohne Arbeit und ohne Wohnung, denn alles gehörte dem Staat.
Der Preis der Wiedervereinigung war für diese Menschen extrem hoch, und noch heute – wenn man mit ehemaligen Bergleuten spricht – spürt man die Leere, die diese untergegangene Welt hinterlassen hat. Der Übergang zur »Marktwirtschaft« verlief viel zu schnell und zu radikal. Unmenschlich. Millionen Bürger, die mit bestimmten Werten aufgewachsen waren und stolz darauf waren, Teil eines großen Produktionssystems zu sein, wurden plötzlich zu Waisen – ohne Land, ohne Traditionen. Alles musste sich dem westlichen System anpassen.
Der Thomas-Müntzer-Schacht ist heute ein Bergwerksmuseum. Bis zum Sommer 1990 hatten 6000 Männer hier Arbeit – heute sind es noch fünf, die als Museumswärter tätig sind. Wir entscheiden uns, in einem Dorf bei Sangerhausen essen zu gehen. Es ist wieder Abend. Wir finden ein winziges Lokal, gehen hinein, um einen Happen zu essen und zu sehen, ob sich etwas verändert hat.
Der Übergang zur »Marktwirtschaft« verlief zu schnell und zu radikal.
-
Drinnen schlucken die alten Gäste schweigend Fleisch mit Kartoffeln hinunter. Ihre Gesichter sind traurig. An den Wänden der Gaststätte hängen Pappbilder mit Hirschmotiven und altmodischen Lampen – alles wie im Film »Good Bye Lenin«. Auch die müden Gesichter der Frauen hinter ihren Bierkrügen erzählen nichts mehr vom Alltag des real existierenden Sozialismus. Jetzt reden sie nur noch von Arbeitslosigkeit und Verzweiflung – ein Gefühl düsterer Nostalgie macht sich breit.
Diesmal geht es schnell über die Autobahn, es gibt keine Kontrollposten mehr. Die modernen Straßeninfrastrukturen waren das erste große gesamtdeutsche Projekt nach 1990. Der Eindruck ist, dass Deutschland körperlich wiedervereinigt wurde – aber die Unterschiede bleiben.
Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.
Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln
Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.







