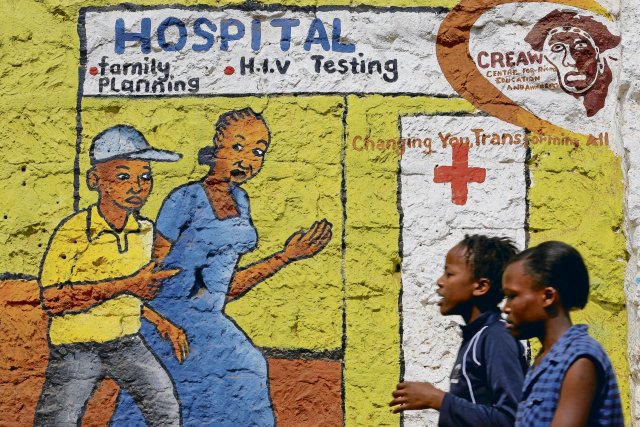- Wirtschaft und Umwelt
- »Leben ganz unten« von Christopher Wimmer
»Das gute Leben ist Ruhe«
Marginalisierung ist vielschichtig. Ein Versuch einer Aufarbeitung mit Betroffenen, abseits von Sozialromantik

Der Rentner Herbert Kieserling isst manchmal ab nachmittags nichts mehr. »Ich bin ja älter, da braucht man nicht mehr so viel«, rechtfertigt er sich. Markus Nordkreuz, als DDR-Bürger nach der Wende nach Süddeutschland ausgewandert, geht selbst mit gebrochenem Zeh der sogenannten Schwarzarbeit nach. Nicht unbedingt, um sich ökonomisch abzusichern, sondern zum Schutz vor sozialer Verachtung. Ihm gelingt es trotzdem nicht, »die gesellschaftliche Wertschätzung zu erhalten, die allein der Lohnarbeit vorbehalten ist«. Helma Keitel, 53 Jahre alt, erwerbs- und obdachlos, fasst die Situation für sich und alle zusammen: »Die Armut bestimmt mein Leben und nicht andersrum.«
Kieserling, Nordkreuz und Keitel heißen tatsächlich anders. Sie sind drei von etwa zwei Dutzend Personen, die Christopher Wimmer für sein Buch »Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft« in Notunterkünften, Teestuben und an Straßenecken interviewt hat. Wimmer will die Sicht marginalisierter Menschen in Deutschland aufzeigen, ohne Sozialromantik anheimzufallen. Seine Arbeit ist eine verspätete Antwort auf Realityshows wie »Frauentausch«, »Mitten im Leben« und die Bücher von Thilo Sarrazin und Paul Nolte, die ab Mitte der 2000er den Unterschicht-Diskurs prägten.
»Die Armut bestimmt mein Leben und nicht andersrum.«
Helma Keitel*
Aus jenem Diskurs werden heute Argumente in der Debatte um das Bürgergeld und die Neue Grundsicherung gezogen, um Sanktionen zu fordern und Armut als selbst verschuldete Situation von Einzelpersonen zu manifestieren, sie also zu marginalisieren. Auch einige der Gesprächspartner*innen von Wimmer greifen das Narrativ auf. Die Erzählung der Eigenverantwortung ermöglicht es ihnen, zumindest auf einer theoretischen Ebene etwas an der eigenen Situation zu ändern, vermutet Wimmer.
Er begreift Armut dagegen als ein »Produkt von menschlicher Praxis, von Macht und Gehorsam, Herrschaft und Unterdrückung«. Der Staat benötigt arme Menschen demnach als ideologische Rechtfertigung. Sie dient dazu, Betroffene, andere Erwerbslose und Beschäftigte zu disziplinieren. Wimmer schreibt von Erwerbslosigkeit statt von Arbeitslosigkeit, weil ein Leben ohne Arbeitsstelle nicht per se ein Leben ohne Arbeit bedeutet. Die von ihm befragten Menschen leisten »Schwarzarbeit«, unbezahlte Sorgearbeit, sie sammeln Pfandflaschen oder engagieren sich ehrenamtlich.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Die soziale Marginalisierung der Befragten zeigt sich vielschichtig in Geldnot, Erwerbs- oder Wohnungslosigkeit, in sozialer Isolation, gesundheitlichen Problemen – oder all jenen Faktoren zugleich. Aus den persönlichen Anekdoten seiner Gesprächspartner*innen lassen sich vier Grundtypen im Umgang mit Armut zusammenfassen. Die 50-jährige Veronica Mittermeier gehört zu den »Aktiv-Handlungsfähigen«. Sie hat vor Kurzem ihren Job als Floristin verloren, strukturiert ihren Alltag aber weiterhin und erhält sich eine »Ich schaffe das schon«-Mentalität.
»Man steht morgens auf, man macht sich zwar frisch, man isst nix mehr morgens und greift morgens zur Flasche, zum Bier.«
Achim Ganz*
Unter den »Ruhig-Resignierten« spricht dagegen Achim Ganz von seinen Erfahrungen, als »hätte er sich selbst als Subjekt aufgegeben«, schreibt Wimmer. »Man steht morgens auf, man macht sich zwar frisch, man isst nix mehr morgens und greift morgens zur Flasche, zum Bier«, beschreibt Ganz seinen Alltag.
Die »Kämpfend-Entwürdigten« wiederum, wie der 26-jährige Karim Halabi, befinden sich in einem ständigen verzweifelten Versuch, ihre Lebensumstände zu ändern. »Ruhig-Resignierte« Menschen haben schlussendlich solch einschlägige Erfahrungen mit Erwerbslosigkeit, Haftstrafen, Gewalt oder Obdachlosigkeit hinter sich, dass sie eine neue Normalität durch Isolation und sozialen Rückzug aufbauen. So stellt Markus Blum für sich fest: »Das gute Leben ist Ruhe.«
Wimmers Gesprächspartner*innen erzählen von diversen Praktiken der Widerständigkeit – Regelverstöße oder Wege, um bürokratische Hindernisse zu umgehen. Dahinter stehe der Versuch, »die eigene Handlungsfähigkeit in einer fremdbestimmten Situation zurückzugewinnen und sich gegen übermächtige Strukturen zu behaupten«.
Motiviert werden sie, wenn ihre Erfahrungen ernst genommen werden. Dazu, so Wimmer, muss klar werden, dass Marginalisierung nicht auf individuelle Defizite, sondern auf die Funktionsweise des Kapitalismus zurückzuführen ist. Bildung, Löhne oder persönliche Anstrengung werden nicht zu einem wahrhaft guten Leben führen. Dabei gelte zu beachten: »Wer nach der Wut und dem Veränderungswillen marginalisierter Menschen fragt, darf keine Angst vor Widersprüchen haben.«
Christopher Wimmer: Leben ganz unten. Perspektiven vom Rand der Gesellschaft. Papyrossa, 182 S., br., 16,90 €.
Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.
Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.
Dank Ihrer Unterstützung können wir:
→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen
Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.